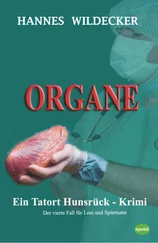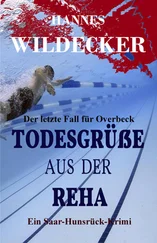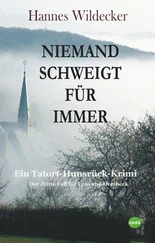Mit einem letzten tiefen Seufzer schob Marek die unangenehmen Gedanken zur Seite. Heute, am späten Abend, hatte er sich aufgemacht, um seinem Wald, seiner Natur nahe zu sein, ohne, dass er dafür besondere Leistungen erbringen musste. Er atmete den Duft des Waldes tief in sich ein. Fichten, Moos und trockenes Gehölz vermischten sich zu einem Aroma, das ihm köstlicher erschien als das teuerste Parfum.
Der Mond schob sich hinter einer dunklen Wolke hervor und tauchte den Wald in einen zarten Silberschein. Marek rappelte sich von seinem Baumstumpf hoch und streckte sich. Sein Rucksack, den er für alle Fälle geschultert hatte, und der außer einer kleinen Wegzehrung nichts enthielt und die Flinte, ein Drilling, in alter Weidmannsmanier gleich einer Schaukel am Riemen nach unten über die Schulter gehängt, mit dem Lauf nach vorne und den Unterarm darauf stützend, waren dabei leicht hinderlich.
Ein Blick auf seine Armbanduhr sagte ihm, dass es inzwischen zwei Uhr war. Eine Stunde noch, dann wollte er seinen Streifzug beenden. Kein Stück Wild hatte er in den vergangenen Stunden gesehen. Wie auch, bei dieser Dunkelheit. „Ich hätte heute erst gar nicht rausgehen sollen“, dachte er. Noch ein paar hundert Meter, dann würde er wieder auf lichtem Gelände sein, dort, wo er sein Fahrzeug, einen kleinen Pick-up-Geländewagen, abgestellt hatte.
Doch kaum hatte er die ersten Schritte hinter sich gebracht, verschwand der Mond wieder hinter einer Wolke und tauchte den Wald erneut in eine fahle Dunkelheit. Leise fluchend tastete sich Marek weiter. Ein Ast fegte ihm den Hut vom Kopf, den er fluchend und tastend schließlich auf der Erde wiederfand.
Gebückt schlug er den Hut gegen seine Beine, auf seine lederne Bundhose über den stabilen Wanderschuhen, um ihn vom Schmutz zu befreien. Der Mond hatte inzwischen die kleine dunkle Wolke durchwandert und tauchte an deren Ende nun wieder hervor, ein gelblichweißes Licht verbreitend. Mit einer schwungvollen Geste wollte sich Marek seinen Hut aufsetzen, doch er verharrte mitten in dieser Bewegung. Das, was sich ihm aus seiner gebückt verharrenden Stellung erschloss, ließ sein Herz verkrampfen und alles Blut aus seinem Kopf entweichen. Für einen Moment glaubte Marek, sämtliches Leben würde aus ihm mit einem Ruck entfliehen. Denn was er dort vor sich sah, jagte ihm, dem erfahrenen Jägersmann, einen grausigen Schauer über den Rücken.
Ein durchdringender Schmerz jagte durch meinen Kopf. Ich zog die Bettdecke bis über die Haarspitzen, um mich vor der störenden Außenwelt abzuschirmen. Das Blut pochte in meinen Schläfen und die Zunge klebte an meinem Gaumen.
Ein Schluck! Ich brauchte einen Schluck! Dann war er wieder da, der stechende Schmerz in meinem Kopf. Es klingelte und schmerzte. So stark hatte ich meinen Tinnitus noch nie wahrgenommen. Schon seit Jahren verfolgte er mich. Auf irgendeinem Rockkonzert hatte ich ihn eingefangen. Ich, der ich ein eingefleischter Fan der amerikanischen, inzwischen antiquierten Rockband „Toto“ bin, habe fast jedes Konzert der Truppe besucht, soweit es in Deutschland stattfand. Aber musikalische Lautstärke hat kaum etwas mit dem Alter der Musiker zu tun.
Wahrscheinlich hatte jeder von ihnen Tinnitus, denn erst seit rund zehn Jahren kann sich der musikalische Akteur durch so genannte Ear-Monitoring schützen. Mithilfe dieser Technik wird ihm nur so viel Lautstärke auf die Ohren gegeben, wie er tatsächlich braucht, um erstens die Qualität seines Schaffens zu kontrollieren und zweitens, dass es ihm nicht das Ohr zerreißt.
Anders dagegen geht es denen, die unterhalb der Bühne stehen und aus mir unbegreiflichen Gründen die Nähe der Boxen mit ihrem riesigen Wattvolumen suchen. Wenn Steve Lukather dann in den höchsten Tönen seine Gitarre quälte, konnte sich der kleine Ohr-pfeifer nicht mehr verstecken.
Er verließ sein Quartier im Mittelohr und stellte sich zum Kampf, den er in fast allen Fällen verlor. Auch mein kleiner Mann im Ohr hatte den Kampf verloren und so blieb ihm in Zukunft nichts Anderes übrig, als zurückzupfeifen, wenn ihm irgendwas an meiner körperlichen Verfassung nicht gefiel.
Doch dann erkannte ich die wahre Ursache des Klingelns: Das Telefon!
Mit verschleierten Augen sah ich auf die fluoreszierenden Zeiger des Reiseweckers, Marke Aldi, auf meinem Nachttisch. Fünf Uhr zehn in der Früh. Samstag und kein Ausschlafen. Ich riss meine Gedanken zusammen und rieb mir durch den harten Stoppelbart, der nun schon genau vier Tage alt war. Wahrscheinlich meine Dienststelle. Hatte ich Bereitschaft?
Langsam kam Ruhe in meinen Körper. Gestern Abend war es spät geworden, sehr spät. Der Stammtisch hatte sich nicht nur in die Nacht hinein verzögert, er hatte sich durch die Mengen Bier und Schnäpse fast durchgebogen.
Ich erinnerte mich. Stammtischbruder Adalbert Schaeflein, mit „ae“, darauf legt der Pastor der Gemeinde Forstenau großen Wert, war Fünfundfünfzig geworden. Eine schöne Feier! Eines Gemeindehirten würdig! Eines Freundes würdig! Es ging hoch her im Pfarrhaus, denn das „Hochwald-Stübchen“ hatte Ruhetag. Dass Schaeflein seinen Namen unbedingt mit „ae“ geschrieben wissen wollte, hatte einen Grund. Zumindest dachte ich mir das. Er ist der Hirte, nicht das Schäflein. Hätte er sich seinen Namen selbst aussuchen können, hieße er vielleicht Hüterli. Aber nein, wohl kaum. Eine einzige deutsche Vorsilbe vor seinem Namen würde ihn vor aller Welt zum Gespött gemacht haben. Außerdem, einen Namen mit Schweizer Endung, kaum auszudenken für einen echten Hunsrücker, geboren in der Nähe von Simmern.
Das Telefon ließ mir jedoch keine Zeit für meine philosophischen geistigen Ergüsse und klingelte aufdringlich weiter. Ich griff nach dem Hörer.
„Spürmann“, meldete ich mich. Meine Stimme klang rau. Die Zunge klebte immer noch am Gaumen. Ich hätte was trinken sollen. Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang etwas unwirsch.
„Spürmann, was ist los, warum melden Sie sich nicht?“ fragte eine Stimme, die nüchtern nicht viel besser klang als die meine am heutigen Morgen.
Es war Willibald Wittenstein, Leiter aller Abteilungen und somit auch des Morddezernates bei der Trierer Kriminalpolizei. Dass er jetzt schon – ich schaute auf die Uhr - um fünf Uhr fünfzehn, auf den Beinen war, hatte nichts Gutes zu bedeuten.
„Spürmann, machen Sie sich fertig. Wir haben eine Leiche im Waldhausener Distrikt.“
„Was ist…?“
„Fragen Sie nicht lange! Sprechen Sie sich per Handy mit der Kriminaltechnik ab. Die können Ihnen den genauen Weg sagen. Die Leute sind schon vor Ort und warten bereits auf Sie.“
Dann wurde es still am Ende der anderen Leitung, oder besser gesagt, es folgten keine Worte. Dafür hörte ich aber das nach Luft ringende Atmen von Wittenstein. In seinem Alter sollte man langsamer sprechen. Ich konnte ihn mir am anderen Ende der Leitung genau vorstellen. In der linken Hand sah ich sein Taschentuch, mit dem er ständig den Schweiß unter seinen weißgrauen Haaren abtupfte. Wittenstein litt unter einer Allergie, welcher Art die aber war, das hatten die Ärzte bisher noch nicht herausfinden können. Bei Witten-stein wirkte sie sich dahingehend aus, dass er bei Erregung nur sehr schwer Luft bekam. Eine vorzeitige Pensionierung kam für ihn nicht in Frage und so lagen noch runde acht Jahre vor ihm.
„Sind Sie noch da?“ fragte ich mit einem leichten Grinsen im Gesicht.
„Dass Sie noch da sind, bereitet mir mehr Sorgen!“ keuchte Wittenstein. „Also auf, Herr Hauptkommissar, sputen Sie sich. Die Nacht ist doch sowieso fast `rum.“
Ich wollte gerade auflegen, da sagte er etwas, das mich mit einem Schlag munter werden ließ.
„Ich lasse Ihnen eine Kollegin zukommen, sie wird am Tatort zu Ihnen stoßen. Eine Neue, wurde uns gestern zugeteilt. Kümmern Sie sich um sie!“
Читать дальше