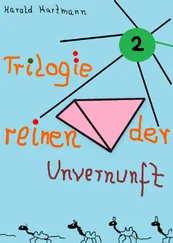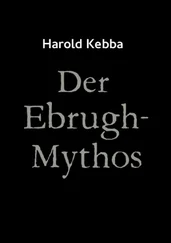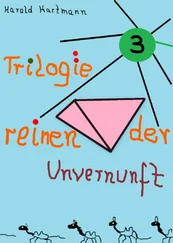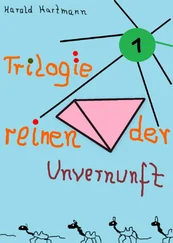An der Bushaltestelle besteige ich den wartenden Bus. Er ist fast leer. Ich stelle die Brötchentüte auf einen Sitz, verabschiede mich von ihr und steige schnell wieder aus. Bin ich jetzt frei? Ich frage mich, ob das Gefühl für Freiheit genau so relativ ist wie das Gefühl für heiß oder kalt. Der Bus fährt ab. Ich sehe ihm nach. Ich bin allein und friere in der Sonne. Es ist ein ausgesprochen angenehmes Gefühl. Bis jetzt war mir unbekannt, dass Frieren angenehm sein kann. Tatsächlich schützt es meine Alleinheit. Ich bin wie ein unschmelzbarer Eisberg am Äquator, der in der Sonne friert.
An der Fußgängerampel überquere ich bei Rot die Kreuzung. Fast erwischt mich ein Auto. Es hatte Glück. Mit einem Eisberg ist nicht zu spaßen. Der Autofahrer schimpft. Ich sage nichts. Ich habe plötzlich große Sehnsucht nach den Brötchen, jetzt, wo sie weg sind. Immer wieder treibt die Ungleichzeitigkeit ihre Scherze mit mir. Ich spüre, dass ich zu schmelzen beginne.
„Du sollst nicht schmelzen“, höre ich eine Stimme.
Ich drehe mich zur Seite, von woher ich die Stimme vermute und blicke in einen Blumengarten. Kein Mensch ist zu sehen. Nur ein Schmetterling, der sich auf einer Blume niedergelassen hat. Ich habe das Gefühl, als beobachte er mich interessiert. Auch ich beobachte mich interessiert. Ich schmelze nicht mehr. Ich sehe, dass ich ein Eisberg bin. Wieder und immer noch.
Die Erleichterung über meine wiedergefundene Stabilität, währt aber nur kurz. Bevor ich mich darüber freuen kann, ändert sich meine Wahrnehmung abrupt. Ich finde mich wieder inmitten atemloser Geschäftigkeit als ein von allen Seiten bedrängter, umlagerter, hin und her gestoßener Eisberg. Alles um mich herum geht, alles fährt. Ich suche den Himmel ab nach einem Fixstern, der mich retten könnte. Es ist laut. Eine unablässig sprudelnde Quelle von Lärm aller Art erzählt mir, was ich höre, sei das Meeresrauschen. Von der großen Plakatwand am Straßenrand überfällt mich der Blick einer Frau, eisern und von glatter, professioneller Freundlichkeit. Ich bleibe distanziert und argwöhnisch, verdächtige sie eines Medusenblicks, dem ich mich nicht unterwerfen will. Sie gibt nicht auf. Obwohl es nur ein Foto ist, höre ich sie doch sprechen. Sie sagt in unermüdlicher Wiederholung mit schmeichelnder, unerbittlich gleichbleibender Kreidestimme immer dieselben drei Worte:
„ Aufhören ist verboten. Aufhören ist verboten. Aufhören ist verboten.“
Ihre penetrante, neutrale Freundlichkeit macht mich aggressiv. Ich stehe da als Eisberg und kann es nicht vermeiden, die Worte zu hören, sie in mich eindringen zu lassen. Ich kann meine Kreise nicht geschlossen halten. Ich spüre, wie diese unterschiedslose Wiederholung ihrer Worte sich meiner bemächtigt, mich allmählich aufweicht und glättet, bis zu dem Punkt, da ich ihr zu erliegen drohe. Noch eine Sekunde, und ich will mich nur noch einreihen und mitmachen, mitschwimmen in diesem Strom, in dieser festgelegten Unaufhörlichkeit, leben in einem von mir selbst angetriebenen Laufrad und einstimmen in den Chor, der dieses Tun als Tat einer unabweisbaren Vernunft verkündet, sogar der besten von allen, und der nicht müde wird, dieses Land der Alternativlosigkeit zu preisen, das keine anderen Wege mehr irgendwohin kennt und auch nicht kennen muss, weil hier das Ende des Weges ist.
Ich schmelze wieder. Kein Schmetterling ist zu sehen, der mich retten könnte. Ich muss es selbst tun. Ich greife zum letzten Mittel und beende mein überkochendes Denken. Und mein Blick wendet sich leicht, wie gelöst oder erlöst? von einer festgezogenen Schraube, ab von diesem zu mir sprechenden Plakat, und ich beginne, in der Sonne zu frieren. Wieder. Es funktioniert. Ich entkomme. Keiner scheint davon Notiz zu nehmen. Als Eisberg habe ich eine gute Tarnung. Ist Tarnung die Grundvoraussetzung für Freiheit?
Lange stehe ich an der großen Straßenkreuzung und beobachte den Verkehr. Ich verstehe gar nicht, warum ich es vorhin nicht gemerkt habe. Es gibt keine Lücke in diesem Strom, in die ich mich hätte einreihen können. Alle Kreise sind geschlossen.
Mein Blick fällt auf ein riesiges Verkehrsschild in der Mitte der Kreuzung, als ich mich ihr nähere. Dicke, schwarze Pfeile auf ihm zeigen unmissverständlich geradeaus. Es ist mir noch nie aufgefallen. Ist es etwa neu? Ich muss zugeben, dass ich es nicht weiß. Doch als ich die Worte über den Richtungspfeilen lese, wird mir klar, dass ich ein Falschfahrer bin. Unübersehbar und in Großbuchstaben steht da: SKLAVEN
Langsam senke ich den Kopf und sehe an mir herunter. Ich trage keine Sklavenkleider. Das ist es. Alle haben es längst gesehen. Jetzt erst spüre ich das Misstrauen in ihren verstohlenen Blicken. Ich spüre einen aus der Sehnsucht, dieser weggeschlossenen und gefesselten, gespeisten Neid. Obwohl niemand zu mir spricht, verstehe ich das lauthals mir entgegen geschleuderte Unausgesprochene. Sie behaupten, meine Kleider seien Affenkleider und außerdem zerrissen, eine unakzeptierbare Kombination. Und dabei können sie ihre Enttäuschung über sich selbst und ihre Sklavenkleider nicht hinter ihrer schicken Uniformität verbergen. Wenn sie nur ein wenig neugierig wären, dann könnte ich ihnen den Riss in meiner Hose leicht erklären. Doch ich erkenne nicht das flüchtigste Anzeichen einer beginnenden Neugier.
Wenn ich mich jetzt friedlich zu verhalten versuchte und einfach nur Platz nähme auf einer Bank am Rande des Marktes, um zu zeigen, dass ich niemanden provozieren möchte mit meinen Kleidern, so könnte mir das eventuell als Provokation ausgelegt und missgedeutet werden. Es ist besser, ich verschwinde von hier und gehe durch eines von diesen Wurmlöchern. Sie sind überall zu finden. Doch noch niemals habe ich mich getraut, sie zu benutzen. Immer hat man mich davor gewarnt. Heute gehe ich.
Ich betrete eine kleine Seitenstraße. Ich kenne sie nicht. Aber ich fühle, dass eine Aufregung meinen ganzen Körper überschwemmt wie die schäumende Gischt einer Meereswelle, die meinen Nacken trifft und über meinen Kopf nach vorn spritzt. Ein Kellner tritt an mich heran und fordert mich auf, sein Eiscafé zu beehren. Er hat die Stühle schon heraus gestellt. Es ist sonnig und mild. Gerne nehme ich seine Einladung an. Ich kann eine Erfrischung gut gebrauchen. Ich sehe, dass seine Kleidung auf links gewendet ist und eine aufgerissene Stelle an seiner Hose aufweist, die untrüglichen Insignien der Freiheit. Er weiß, dass ich es bemerkt habe und und schickt mir schnell eine einladende Geste. Ich nehme Platz. Es ist die einladenste Geste, die mir je entgegengebracht wurde. Ich bestelle ein großes, gemischtes Eis ohne Sahne. Nur Eis für den Eisberg. Er bringt zwei und setzt sich zu mir an den Tisch.
„Ich freue mich, dass du den Weg hierhin gefunden hast“, sagt er.
„Ich freue mich auch!“, sage ich. „ Wie heißt diese Straße?“
„Sie hat keinen Namen“, sagt er.
„Wohin führt sie?“, frage ich.
„Der einzige, der diese Frage beantworten kann, bist du“, sagt er.
Ein heftiger Windstoß bläst mir ins Gesicht. Erstaunt blicke ich mich um. Ich sitze nicht in einem Eiscafé sondern auf einer Bank am Rande des Marktes. Ich bin wohl kurz eingenickt. Keiner beachtet mich. Jeder ist beschäftigt. Heute ist Markttag. Alles läuft normal. Die Marktschreier schreien, die Käufer kaufen. Die Welt ist in Ordnung. Nein, doch nicht! Irgendetwas stimmt nicht. Ich kann es wittern. Dann weiß ich es. Ich bin der Einzige, der sitzt und beobachtet. Ich bin der einzige Zuschauer in diesem Theater. Die Bühne ist gefüllt mit Schauspielern, die zwischen den Marktständen hin und her gehen und alles mögliche austauschen. Mimik, Gestik, Ware, Geld, Farben, Düfte, Geräusche. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, der einzige Zuschauer in einem Theater zu sein, dazu noch eins mit so vielen Akteuren. Doch irritiert sehen sie nicht aus. Sie scheinen es gewöhnt zu sein, vor wenigen Zuschauern zu spielen. Sie sehen aus, als glaubten sie, es müsse so sein. Ein Zuschauer ist genau richtig. Alle spielen großartig. Natürlich erwarten sie auch keinen Applaus. Das fällt mir allerdings nicht leicht angesichts der dargebotenen Leistungen. Doch weiß ich mir zu helfen. Ich stecke meine Hände in die Sicherheit meiner nun innen liegenden Hosentaschen, um ein spontan ausbrechendes Applaudieren zu vermeiden.
Читать дальше