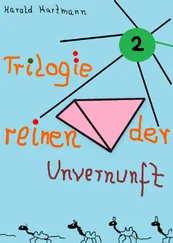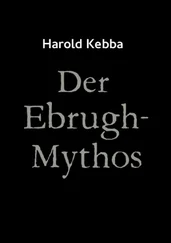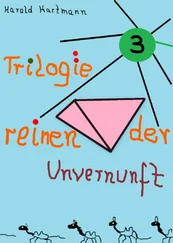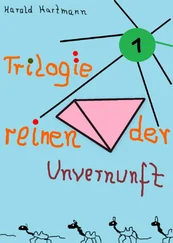Natürlich haben auch seine schon vorher eingetroffenen Kollegen sein unfreiwilliges, erzwungenes Manöver mitverfolgt. Doch Mitgefühl und Trost ist nicht von ihnen zu erwarten. Ich beobachte es vom Küchenfenster aus, während ich vor mich hin kaue. Vor dem Eingang des Bürogebäudes stehen die Kollegen in ihrer Firmenkluft im Kreis und reden. In der linken Hand der Kaffeebecher, in der rechten die Zigarette. Schadenfroh grinsend nehmen sie ihn auf in ihren Kreis, den Loser, den schon um diese Tageszeit schwer Gebeutelten. Alle wissen Bescheid. Ihr Trost, den sie ihm spenden, ist allenfalls spöttisch. Und einer feixt sogar ganz offen und gefühllos, angelockt wie eine Hyäne von dem Geruch frischen Blutes. Der so Geärgerte bewahrt jedoch seine Beherrschung und tut so, als merke er nichts davon, dass die Kollegen fröhlich ihre Finger in die noch offene Wunde drücken, droht ihnen aber im Geheimen mit Rache, diese süße Medizin der Verlierer, die helfen soll, den Schmerz zu betäuben. Bald sehe ich ihn mit einem Kaffeebecher in der linken Hand und mit einer Zigarette in der rechten. Die Welt ist wieder in Ordnung gezwungen. Natürlich wäre es noch besser, wenn er auch den richtigen Parkplatz hätte. So aber werden die Wellen dieses morgendlichen Bebens die Konzentration auf seinen Arbeitsablauf sicher bis weit in den späten Vormittag hinein beeinträchtigen.
Ich verstehe ihn. Ich spüle mein benutztes Geschirr und stelle es auf das Abtropfblech neben dem Becken. Ich stelle es auf in immer derselben Anordnung. Meine Welt ist in Ordnung. Ich spüre das Aufbegehren meiner Müdigkeit gegen diese Meinung, und wieder sage ich Scheiße. Wie immer an dieser Stelle. Es fällt mir auf heute morgen. Es fällt mir unangenehm auf. Warum fällt es mir überhaupt auf? Ich will gar nicht, dass es mir auffällt. Ich will meine Ruhe. Vielleicht hat mich eine Krankheit befallen, und ein Virus, der meine Schaltkreise zerstören will, greift mich an. Wenn er über mich siegt, bleibt mir nichts anderes übrig, als selber zu schalten und auf Handsteuerung umzustellen. Es wäre eine Premiere, der Ausgang ungewiss. Ich bekomme Angst. Ich befürchte, dass es keinen Schutz mehr für mich gibt, wenn alle Kreise zerstört sind. Jeder wird es mir ansehen. Ich werde ein Geächteter sein. Jeder hat dann das Recht, mich zu töten. Ich werde vogelfrei sein. Ich muss etwas dagegen unternehmen. Ich muss meine Immunkräfte stärken. Ich muss meine Kreise geschlossen halten. Ich muss sie abwehren, diese Angreifer, diese gleichsam Außerirdischen aus den unendlichen Weiten meines Körpers. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Aufgeregt suche ich nach meinen Waffen. Doch muss ich schließlich zugeben, dass ich keine habe. Ich muss sie erst noch selbst herstellen.
Der letzte Bissen ist geschluckt, mein Magen zufriedengestellt. Ich gehe zum Briefkasten und hole die Morgenzeitung. Ich begebe mich zur Toilette. Ich lese. Es sind dieselben Schlagzeilen und Berichte wie gestern, vorgestern und vorvorgestern. Das hört sich beruhigend an. Trotzdem geht es mir nicht besser angesichts meiner Befürchtungen. Ich denke über diesen Sachverhalt nach. Egal, was ich denke, egal wie klug ich rechne, immer komme ich auf dasselbe Resultat. Ich weiß, dass es falsch ist. Nein, das stimmt nicht. Ich muss mich korrigieren. Es ist etwas anderes als wissen, etwas, das dem Wissen erst seine Basis gibt. Es ist der Boden unter dem Meeresboden, der mich zweifeln lässt. Es ist ein diffuser, unkonkreter Zweifel. Es ist der Urzweifel, der Zwillingsbruder meines lange schon verschollenen Urvertrauens, der sich meldet. Mein Misstrauen wächst. Es sagt mir, ich soll nicht glauben, was ich glauben soll. Ich glaube nicht, dass das Resultat richtig ist.
„Das Resultat ist richtig, das Resultat ist richtig, das Resultat ist richtig“ hämmert sogleich die Antwort auf diese Unbotmäßigkeit wie ein Ohrwurm in meinem Kopf dagegen an.
Immer derselbe Satz. Ich sehe auf die Uhr. Ich muss los. Ich gehe nicht. Augenblicklich stellt der Ohrwurm seine Arbeit ein.
Ein Siegesgeheul wie nach einer gewonnenen Schlacht erfüllt die Küche. Ich tanze dazu einen wilden Tanz. Auch die Nachbarn scheinen davon begeistert zu sein. Ich höre, dass auch sie tanzen und laut dazu singen. Doch vielleicht irre ich mich auch, und sie versuchen nur, ihre Kreise geschlossen zu halten und die Angriffe ihrer Außerirdischen abzuwehren.
Ich beende meine Aktion und ziehe mich wieder aus. Komplett. Ich werfe alles auf einen Haufen und sehe, dass es Sklavenkleider sind. Langsam und neugierig betrachte ich diese vor mir aus dem Boden gewachsene Skulptur aus Kleidung wie das Dokument einer soeben untergegangenen Kultur. Es überrascht mich, wie ich jenseits aller rührseligen Emotionen dies als Tatsache zur Kenntnis nehmen kann, als hätte ich mich ihrer zusammen mit den Kleidern entledigt. Ich weiß, dass ich nie wieder Sklavenkleider tragen kann. Und ich weiß, dass ich es auch nicht brauche. Es ist nämlich ganz leicht, es nicht zu tun. Ich wundere mich darüber, dass ich es nicht schon früher bemerkt habe. Ich drehe einfach alle Kleidungsstücke auf links und ziehe sie wieder an. Jetzt sind es keine Sklavenkleider mehr.
Der Eisberg, der in der Sonne friert
Ich sehe in den Spiegel, bevor ich die Wohnung verlasse. Ich bin neu. Diese Aussage blickt mich an, und ich weiß, dass es nicht nur an den neuen Kleidern liegt. Es ist noch etwas anderes. Doch, obwohl es so etwas Offensichtliches sein muss, dass ich darum weiß, kann ich nicht sagen, was genau es ist. Ich sehe es und sehe es doch nicht. Wie ist es möglich, dass sich zwei Unvereinbarkeiten, Sehvermögen und Blindheit, vereint haben, zu einer gemeinsamen Aktion finden und in mir wirken? Aufgeregt suche ich nach Erklärungen. Vergeblich. Um mich zu beruhigen, fange ich an, ganz heftig zu rechnen. Wenn ich ehrlich bin, rechne ich fast unaufhörlich, so wie man es mir beigebracht hat zu tun, damit ich die Welt verstehe. Ich stelle fest, dass ich Erinnerungen an etwas anderes als Rechnen gar nicht habe. Vielleicht wurde alles andere schon lange aus der Schrift meiner Gene und sogar der meiner Vorfahren entfernt. Das Rechnen duldet keinen anderen Gott neben sich. Ich rechne die Einnahmen, die Ausgaben, die Erwartungen. Plus, Minus, Durchschnitt, Prozent, Mal, Geteilt, Kurven und Winkel. Als schöne und vernünftige Sache will solches Tun mich schmeichelnd umgarnen und wie eine sanft lächelnde Schlange mit großen, verführerischen Augen mich in einer ewigen Hypnose versinken lassen. Und jetzt stelle ich fest, dass das Resultat falsch ist. Etwas stimmt hier ganz und gar nicht. Unauffällig blicke ich mich um. Rechnen wird mir langsam verdächtig. Es stolziert einher, als sei es die einzige Möglichkeit der Existenz, und wenn man genau hinsieht, ist das Resultat falsch. Und ich soll glauben, es gäbe keine Alternative zu ihm. Wenn es so wäre, bliebe mir nur ein Weg. Ich müsste mich arrangieren mit dem falschen Resultat. Ich müsste meine Sklavenkleider wieder anziehen, eine Vorstellung, die ich niemals akzeptieren werde. Niemals! Eine wilde Entschlossenheit schleudert dieses Wort aus meinem Mund, und ich reibe mir die Augen, ungläubig, wie gerade erwacht und meiner Verzauberung entronnen.
„Das Rechnen ist kein unverlassbarer Raum“, rede ich weiter zu mir selbst, „ich werde es ihm zeigen. Ich will mich nicht weiter von ihm täuschen lassen.“
Fast bin ich erschrocken über meine entschlossene Kampfansage. Doch stürze ich mich in den sich vor mir auftuenden Abgrund, muig, wie ich mir später im Rückblick bescheingen muss. Von einem zum anderen Augenblick höre ich auf zu rechnen.
Ich verlasse die Wohnung über die Feuerleiter. Es ist ein gefährlicher Weg. Ich darf ihn nur im Notfall benutzen. Sonst ist er verboten. Aber hier handelt es sich eindeutig um einen Notfall, weil das Resultat falsch ist. Ich habe ein gutes Gewissen. Ich tue das Richtige.
Читать дальше