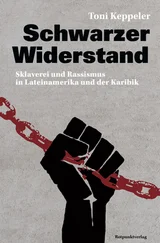Der Schlüssel war Liebrechts U-Boot-Prototyp gewesen – die Nautilus. Er hatte das zwanzig Meter lange Schiff auf einem Eisenbahnwagen, der extra angefertigt worden war, durch ganz Deutschland transportiert. Eine Ummantelung aus Brettern hatte verhindert, dass jemand Wind davon bekam. Derartig maskierte Transporte waren zu dieser Zeit nicht ungewöhnlich und erregten nur wenig Aufsehen. In Friedrichshafen fand die Nautilus dann ihr erstes Zuhause. In einer Werfthalle, in der vormals Fähren gebaut worden waren, blieb sie unter Verschluss. Wenn sie nachts zu ihren Fahrten aufbrach, wurde streng darauf geachtet, dass keine Schaulustigen in der Nähe waren. Auf Schweizer Seite hatte er über die Bank einen alten Fischereibetrieb aufgekauft und über dem Bootsanleger eine kleine Halle errichtet, so dass sie auch hier unbeobachtet blieben.
Doch dann rückten die Luftangriffe der Alliierten immer weiter ins Landesinnere vor, bis sie schließlich auch Friedrichshafen erreichten. Zahlreiche Rüstungsbetriebe hatten ihren Sitz am Ufer des Bodensees: Zeppelin, Maybach, Dornier und die Zahnradfabrik. Hektisch wurde nach Möglichkeiten gesucht, die Produktionsstätten zu verlagern und so stieß man auf die Molassefelsen bei Überlingen, die direkt an der Bahnlinie lagen. Das weiche Gestein ließ sich leicht aushöhlen, die Arbeitskräfte dafür kamen überwiegend aus dem Konzentrationslager in Dachau. In rund hundert Tagen sollte in den geschaffenen Höhlen die Produktion von Rüstungsgütern wieder anlaufen. Doch auch Ummenhofer brauchte einen neuen Platz für die Nautilus. Durch Zufall stieß er auf die pompöse Villa im Stil der Zwanzigerjahre, die einem reichen Optiker gehörte. Der Mann fiel seit Jahren durch seine ablehnende Haltung gegenüber der Partei auf – ein Wunder, dass er noch nicht eingesperrt worden war. Ummenhofer änderte das mit einem einzigen Anruf und machte sich sofort daran, über der kleinen Anlegestelle eine Halle zu bauen. Mit über dreißig Metern war sie lang genug für die Nautilus. Der Optiker hatte den Privathafen für seine private Yacht bauen lassen. Dekadent.
Ummenhofer wohnte auch in der Villa. Der Kapitän der Nautilus war zum Schein als Diener und Gärtner eingestellt worden, der Maschinist des U-Boots offiziell als Verwalter. Es hatte sich herausgestellt, dass zwei Mann ausreichten, um das kleine U-Boot sicher zu bedienen. Und so gingen die Lieferungen in die Schweiz weiter.
Heute sollte eine neue Ladung eintreffen. Endlich entdeckte Ummenhofer am Horizont die Rußwolke der Lok. Anderthalb Stunden Verspätung. Eine Schande. Als der Zug einfuhr, standen die Soldaten schon zum Entladen bereit. Gut zwanzig neue Arbeiter wurden auf dem wartenden LKW zusammengepfercht. Ausgemergelte Kreaturen, von denen manche schon auf dem Weg zum Fahrzeug zusammenbrachen. Zwei weitere Soldaten kümmerten sich um Ummenhofers Lieferung. Die Holzkisten ähnelten in ihrer Form gewöhnlichen Munitionskisten, waren aber um ein Vielfaches schwerer. Nur Ummenhofer wusste, dass jede Kiste exakt zwanzig Kilo Gold enthielt. Diesmal waren es sechs Stück. Die kleinen Barren im Inneren waren frisch gegossen und neutral gestempelt – also ohne Hakenkreuz oder andere Kennzeichnungen. Die Herkunft des Goldes interessierte Ummenhofer nicht, doch er ahnte, dass darin eine Menge Zahngold und geschmolzene Schmuckstücke verarbeitet waren.
Gerade als sein Fahrer den LKW zum Tor lenkte, gab es bei einer der Baracken einen kleinen Tumult. Er sah hinüber und beobachtete, wie Soldaten eine Gruppe Häftlinge auseinander trieb. Ein Schuss fiel. Einer der Gefangenen blieb reglos liegen. Ummenhofer sah wieder nach vorn. Er musste an andere Dinge denken. Heute Nacht würde die Nautilus wieder in See stechen.
08. August 1998
„Hier sind deine Sachen“, sagte der Wärter unfreundlich und warf Barnsteiner eine Tüte zu. Der kontrollierte den Inhalt und sah den Uniformierten herausfordernd an.
„Da fehlen zweitausend Mark in meinem Geldbeutel!“
„Als ob du jemals so viel Kohle besessen hättest.“
Der Wärter unterschrieb auf einem Formular und bedeutete Barnsteiner das Gleiche zu tun. Knurrend setzte er seine Unterschrift auf das Papier und ließ sich von einem anderen Wärter zum Ausgang bringen. Es war ein seltsames Gefühl nach vier Jahren einfach so durch die Tür zu gehen. Nach draußen. In die Freiheit.
Bernd Barnsteiner war ein gewöhnlicher Kleinkrimineller gewesen und hatte sich mehrmals bei Einbrüchen erwischen lassen und so war es irgendwann mit den Bewährungsstrafen vorbei gewesen. Zu fünfeinhalb Jahren hatte ihn der Richter verurteilt, wegen guter Führung durfte er nach vier Jahren und zwei Monaten gehen. Heute. Seine „gute Führung“ bestand vor allem darin, während seiner Haft den Realschulabschluss nachzuholen und eine Lehre zum Kfz-Mechaniker zu beginnen. Die Beschäftigung war ihm nur recht gewesen. Wer sich das Gefängnis wie eine Ein-Sterne-Urlaubspension vorstellte, hatte keine Ahnung von der Realität. Schon nach der ersten Woche in der Zelle hatte ihn die Langeweile fast verrückt gemacht. Hinzu kam der Verlust jeglicher Privatsphäre. Die Zellen wurden regelmäßig durchsucht und außer zum Sport und zum Hofgang war er mit seinem Zellengenossen auf sechs Quadratmetern eingeschlossen. Er hätte es schlimmer erwischen können als mit Juri. Der gebürtige Russe war eine echte Fachkraft auf dem Gebiet des Autodiebstahls, glänzte aber nicht durch übermäßige Intelligenz. Dafür war er skrupellos. Als Bernd einmal Ärger mit einem anderen Häftling hatte, regelte Juri die Streiterei durch ein körperbetontes Gespräch unter der Dusche. Nach seinem zweiwöchigen Aufenthalt auf der Krankenstation war der andere überaus freundlich gewesen.
Nun war er also draußen. Die restliche Strafe war zur Bewährung ausgesetzt und an Bedingungen geknüpft: er musste sich einmal die Woche bei seinem Bewährungshelfer melden, hatte einmal im Monat eine Sitzung beim Psychologen und musste seine Lehre fortsetzen. Die Sozialarbeiterin des Gefängnisses hatte ihm eine entsprechende Stelle besorgt. Mit ihr hatte er sich gut verstanden. Sie war hübsch genug gewesen, um ihn gelegentlich in seinen feuchten Träumen zu besuchen. Vielleicht sollte er sie mal anrufen? Jetzt, wo er frei war. Die vier Jahre im Knast waren auch vier Jahre ohne Sex gewesen. Manche Häftlinge arrangierten sich mit der Situation und halfen sich gegenseitig, doch das war für ihn nie in Frage gekommen. Er freute sich auf seinen ersten Abend in Freiheit, den er schon seit Wochen geplant hatte: er würde schön essen gehen – nichts Ausgefallenes – aber in ein Restaurant, in dem der Koch mit Gewürzen umgehen konnte. Der Gefängnisfraß hatte sich nur in den Farbnuancen von Grau unterschieden, geschmeckt hatte er immer gleich fad. Mit vollem Bauch und nach dem ein oder anderen Bier würde er sich einen Besuch im Bordell gönnen. Das Mädchen tat ihm jetzt schon leid: alles, was sich in vier Jahren angestaut hatte, würde sich in ihr entladen. Die Vorfreude ließ ihn lächeln.
Er erwachte am nächsten Morgen mit einem ordentlichen Kater. Es waren nur fünf Bier gewesen, doch auch an den Alkohol war er nicht mehr gewöhnt. Das Fest im Bordell war wesentlich kürzer verlaufen, als er es sich vorgestellt hatte. Das blonde Mädchen mit den riesigen Brüsten hatte sich sehr geschickt angestellt, so dass er nach heftigen zehn Minuten zu einem lautstarken Ende gekommen war. Und dafür hundertfünfzig Mark? Nun ja – gute Fachkräfte waren eben teuer.
Er mochte die neue Wohnung, die ihm ebenfalls die Sozialarbeiterin vermittelt hatte. Zwar nur ein Zimmer, dafür aber mit einer hübschen Küchenzeile und einem kleinen Balkon. Und günstig war sie obendrein. Große Sprünge konnte er mit seinem Lehrlingsgehalt nicht machen, doch der Staat bezahlte einen Wohnungszuschuss. Für die Arbeit in der Gefängniswerkstatt hatte er einen beschämenden Stundenlohn erhalten, der auf sein Konto eingezahlt worden war. Doch wie bei einer Geldanlage wirkte die Zeit Wunder und es befanden sich bei seiner Entlassung über zehntausend Mark auf dem Sparbuch. Ein Fernseher. Er brauchte unbedingt einen Fernseher. Einen von diesen neuen flachen Bildschirmen. Dafür würde das Geld bestimmt reichen.
Читать дальше