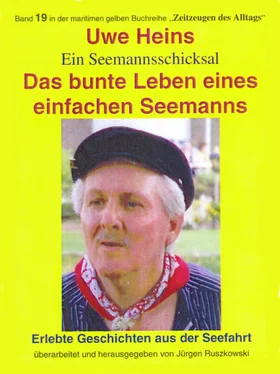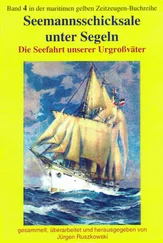Am nächsten Tag waren wir schon wieder auf See, aber nur einige Stunden. Freetown war der nächste Hafen. Auch hier dasselbe Spielchen. Da hier das Löschen über zwei Tage dauerte, hatte ich das erste Mal Gelegenheit, abends an Land zu gehen, aber nicht alleine. Dies war uns von der Schiffsleitung ausdrücklich untersagt worden, und wir hielten uns dran. Viele Matrosen, die diese Reiserouten schon kannten, erzählten fast unglaubliche Storys.
Unglaublich waren auch die Eindrücke, die ich hier bei meinem ersten Landgang abends wieder mit an Bord nahm. Nichts, was an Verhältnisse in Europa erinnerte. Kam man mal von der Hauptstrasse ab, war man sofort in den Gegenden, die man besser meiden sollte. Hier war alles dunkel, und verdächtige Gestalten lungerten überall herum. Oftmals wurde man auch, da man sofort als Europäer erkannt wurde, von aufdringlichen Einheimischen nach Zigaretten gefragt. Ziel der abendlichen Ausflüge an Land waren fast immer Kneipen oder, wie man es hier nannte, Bars. Es waren primitiv eingerichtete Kaschemmen, deren Türen immer offen standen und aus denen auch immer laute Musik zu hören war.
Mein Kammerkollege und einer der Messejungen der Offiziersmesse, die mich begleiteten, brauchten eigentlich nur dem Geräuschpegel folgen, da machte man nichts verkehrt. Ausgelassenheit und Freude herrschte in solchen Bars vor, alleine die farbenfrohe Kleidung der Einheimischen und die vornehmlich jüngeren Frauen waren schon den Besuch wert. Trotzdem waren wir immer wieder froh, wenn wir an Bord zurück waren. Die paar Flaschen Bier, die wir getrunken hatten, machten uns das Einschlafen leicht.
Doch auch Freetown war nur eine kleine Episode entlang der Küste von Westafrika. Weiter ging es zum nächsten Hafen, Monrovia, einem für damalige Verhältnisse großen Hafen, aus dem Schiffe aus aller Welt Eisenerz holten. Hier pulsierte das Leben im Hafen und auch in der Stadt noch mehr als anderswo. Alles war, zumindest im Zentrum der Stadt, schon viel moderner für damalige Zeiten. Die zwei Nächte, die wir in Monrovia waren, nutzen wir fast alle für einen ausgiebigen Landgang. Zumindest die Matrosen schienen hier schon recht heimisch zu sein, denn hier, wie auch noch in einem anderen Hafen, tauchten auch nachts Frauen an Bord auf, obwohl dies verboten war.
Am Tage hatte ich dann auch mein erstes negatives Erlebnis. Nachdem ich von fliegenden Händlern geschnitzte Hartholzfiguren gekauft hatte (Zahlungsmittel waren Zigaretten), was an Deck vor sich ging, brachte ich diese in meine Kammer. Diese lag an Backbordseite, und aus meinem geöffneten Bullauge konnte ich an die Pier sehen. Als ich gerade in der Kammer war, tauchte ein schwarzer Kopf nahe der Öffnung auf und bot mir Sonnenbrillen an. So etwas war hier bei der glühenden Sonne natürlich immer zu gebrauchen, und so wechselten zwei Sonnenbrillen den Besitzer, vier Schachteln Lucky Strike wurden dafür nach draußen gelangt. Damit war der Kauf perfekt, und ich ging wieder meiner Arbeit nach. Als ich Stunden später wieder einmal in meine Kammer kam, staunte ich nicht schlecht, die Holzfiguren, die ich nahe des Bullauges deponiert hatte, waren weg. Da half kein Suchen und Schimpfen. Es war mir klar, dass der Sonnenbrillenverkäufer das offene Bullauge genutzt und die Figuren herausgefischt hatte. Also in Zukunft: Bullauge im Hafen immer geschlossen halten!
Weiteren Unmut bereitete mir manchmal der Blick morgens in die Messe. Immer, wenn ich voller Tatendrang, mitunter auch etwas unter Zeitdruck, das Frühstück vorbereiten wollte, bekam ich einen Schlag. Die Messe sah aus wie ein Schweinestall. Nachts an Bord gekommene Matrosen und Maschinenleute hatten wohl nach ausgedehnter Zechtour an Land erst noch mal so richtig gegessen und Kaffee getrunken. Natürlich war nichts wieder sauber gemacht oder gar weggeräumt worden. Da lagen benutzte Brotbretter, verschmierte Messer, halb volle Aufschnittplatten mit Wurst und Käse. Benutzte Becher mit Kaffeeresten standen auf der Back und die Butter schwamm mehr, als dass sie eine streichfähige Masse war. Brotreste und natürlich Krümel überall. Dass der Fußboden gleichermaßen sein Aussehen verändert hatte, leuchtet wohl allen ein. Zusätzlich waren überall Zigarettenkippen in unzähligen Aschenbechern verteilt.
Schnellstens musste dann von mir alles weggeräumt und gereinigt werden, denn im Hafen tauchten pünktlich die ersten Hungrigen auf.
Endlich mal wieder andere Deutsche
Der nächste Hafen, den wir anliefen, war Abidjan, hier bot sich beim Einlaufen am frühen Nachmittag ein herrliches Bild. Mindestens sechs Schiffe mit dem Heimathafen Hamburg lagen hier an den Kais. Beim Vorbeifahren betätigte der Kapitän unser Typhon als Begrüßung. Das war, wie ich später merkte, so üblich, wenn hier an der Westküste Afrikas andere deutsche Schiffe im Hafen lagen.
Während auch hier zwei Tage lang gelöscht wurde, nahmen viele von uns die Gelegenheit wahr, abends auf ein anderes Schiff aus Deutschland, womöglich noch eins der selben Reederei, zu gehen und dort Besuche zu machen. Das beschränkte sich unter Mannschaftsgraden dann oftmals auf das Leeren von einigen Kästen Bier und den Austausch von mehr oder weniger glaubhaften Gruselgeschichten aus anderen Häfen.
Durch diese Besuche hatte ich wiederum Gelegenheit, auch andere Gegebenheiten auf anderen Schiffen kennen zu lernen. Die Kammergröße für Mannschaftsgrade, die Ausstattung und die Sorten der Biere, vornehmlich deutsches Export, sowie Zigarettenmarken, meist amerikanisch, waren ohnehin gleich.
Ein Gesprächsthema war auch oftmals die Verpflegung. Zu dieser Zeit machte ein Gerücht die Runde, dass aufgrund von schlechten Frachtraten die Reedereien Einsparungsmaßnahmen bei der Verpflegung planen würden, wovon aber keiner etwas Genaues wusste.
Ausflüge mit der Barkasse
Vor unserem nächsten Löschhafen, Accra, gingen wir vor Anker. Riesige Pontons kamen längsseits. Auf die wurde dann die für diesen Hafen bestimmte Ladung gestellt und abtransportiert.
Hier kam auch die an Bord befindliche Barkasse erstmals zum Einsatz. Nachdem die Besatzung sie zu Wasser gelassen hatte, machten wir an einem Wochenende, das wir hier verbrachten, mit zwölf Mann einen Ausflug, einfach den Fluss hinauf. Nach einiger Zeit hatten wir rechts und links richtigen Urwald, den wir aber nicht betraten. Das war wirklich mal eine gute, wenn auch nicht allzu lange Abwechslung.
Obwohl wir hier nur in Sichtweite der Stadt vor Anker lagen, wie übrigens andere Schiffe auch, kamen viele kleine Boote mit fliegenden Händlern längsseits. Sie machten immer auf der Seite des Schiffes fest, an der sie nicht den von Bord gehenden Löschbetrieb störten oder durch ihn gefährdet wurden. Hier kaufte ich, oder besser gesagt, tauschte ich noch einmal Holzfiguren aus ganz schwerem, schwarzem Material gegen Zigaretten. Diesmal aber verstaute ich die Souvenirs gleich in meinem Spind, obwohl hier aufgrund der Höhe keine Gefahr bestand, durchs Bullauge hindurch bestohlen zu werden.
Der Koch droht mit dem langen Messer
Der nächste Löschhafen, Cotonou, brachte aus den Luken sehr viel Stauholz zu Tage, welches auf der dem Land abgewandten Seite in die Gangbord abgelegt wurde, ein wüstes Durcheinander von Planken, Brettern und zerbrochenen Holzteilen. Außerdem lagen hier auch noch dicht am Lukenrand gestapelt die Holzlukendeckel der jeweiligen Luke. Diese Unordnung sollte für mich noch einige Konsequenzen haben, wie sich nur allzu schnell zeigte. Weil es morgens Eier gegeben hatte (bei der Seefahrt gab es jeden Donnerstag Eier), muss es ein Donnerstag gewesen sein!
Mittags ging ich wie gewohnt nach mittschiffs zur Halbtür der Kombüse, um mit dem Tragegeschirr das Essen für die Mannschaft abzuholen. Es gab Pfannkuchen mit Apfelmus bzw. Preiselbeermarmelade, für jeden so, wie er es wollte. Der Weg zurück zur Mannschaftsmesse gestaltete sich aufgrund der schon beschriebenen Verhältnisse als schwierig. Holzbretter lagen ungeordnet wild durcheinander, und ich musste darüber klettern. Dann kam es, wie es kommen musste, ich stürzte und ließ, um mich abzustützen, das Tragegeschirr mit dem Essen fallen. Auf den Brettern lagen jetzt etwa 30 große Pfannkuchen, etwas davon entfernt die beiden Gefäße mit dem Apfelmus und den Preiselbeeren, zum Glück nicht umgestürzt. In manchen Situationen hat man eine Eingebung! Ich hatte genau in dem Moment meine. Als ich merkte, dass mich keiner sah, packte ich die Pfannkuchen mit den Händen, rieb kurz die daran haftenden Sägespäne und Holzsplitter ab, bzw. meinte dies zu tun – alles rein in das Gefäß, ein kurzer Blick noch in Richtung Kombüse, einer in Richtung achtern zu den Bullaugen der Messe – und ab ging es wie die Feuerwehr in die Messe. Hier war noch keiner der Mannschaft. Ich hatte aber gerade die Pfannkuchen auf die dafür vorgesehenen großen Platten gelegt, schnell noch einige Splitterchen beseitigt, als die ersten Hungrigen schon kamen. Argwöhnisch sah ich zu, wie die Leute zulangten, sich einen Pfannkuchen auf den Teller legten, Apfelmus darauf füllten, es etwas verstrichen - oder eben dasselbe mit den Preiselbeeren - und anfingen genüsslich zu essen.
Читать дальше