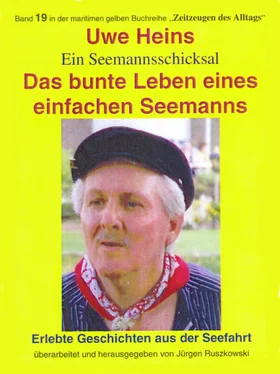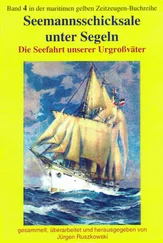Die 24 Stunden eines Tages teilten sich für die Decksbesatzung in drei Wachen auf: 4 bis 8 Uhr, 8 bis 12 Uhr und 12 bis 16 Uhr, danach war wieder die 4 bis 8 Uhr-Wache dran mit Wache von 16 bis 20 Uhr, dann war Wache von 20 bis 24 Uhr und von 00 bis 04 Uhr in der Nacht, diese nannte man die „Hundewache“.
Während einer vierstündigen Wachzeit, die mit zwei Mann besetzt war, ging ein Mann Ruderwache, d. h. er steuerte nach Vorgaben des diensthabenden Offiziers das Schiff. Die zweite Person verrichtete andere Sachen, wie z. B. Ausguck bei schlechter Sicht, sorgte mal für Kaffee oder bekam andere Aufgaben vom Offizier. Dieser zweite Mann löste dann nach zwei Stunden den Rudergänger am Steuer ab und die Aufgaben wechselten. Somit waren immer zwei Mann auf Wache und sorgten zusammen mit dem diensttuenden Offizier für die Sicherheit.
Der restliche Teil der Decksbesatzung wurde vom Bootsmann (an Land würde man ihn Vorarbeiter nennen) für Instandsetzungsarbeiten (meistens Rost entfernen und malen) an Deck eingeteilt. Dies waren die so genannten Tagelöhner, die von morgens um 8:00 Uhr bis nachmittags 16 Uhr Arbeiten verrichteten.
Um alle anfallenden Arbeiten, deren Ausführung bei einem Hafenaufenthalt nicht möglich waren, auf See durchzuführen, konnten auch Matrosen sowie Junggrade außerhalb ihrer Wache an Deck arbeiten. Dies nannte man „zutörnen“ (törn tau). Die anfallenden Stunden wurden dann als Überstunden abgegolten.
Bedenken muss man aber, dass diese Zusatzstunden, die außerhalb der Wache zustande kamen, auf Kosten des Schlafes gingen, denn bei den Wachgängern lagen ja nur immer acht Stunden zwischen den Wachen. So war es nur zu verständlich, dass meistens nur vier Stunden zugetörnt wurde, der Rest der Zeit ging dann für Essenszeiten und Ruhepause drauf.
Jetzt wurde es auch schon spürbar wärmer. Wer an Deck zu tun hatte, hielt sich dort nur in ganz leichter Kleidung auf, irgendwann trugen auch einige einen Tropenhelm, der an Bord zur gestellten Ausrüstung gehörte.
Ab und zu konnte man auch Schiffe beobachten. Meist waren sie aber so weit entfernt, dass man nicht einmal die Nationalität erkennen konnte.
Meine mir aufgetragenen Arbeiten machten mir inzwischen viel Spaß. Ich hatte es gelernt, so effektiv wie möglich zu arbeiten und auch die mir am Tage verbleibende Freizeit gut zu nutzen, wenngleich bei der zunehmenden Hitze immer öfter Faulenzen angesagt war.
Irgendwann, nach 16 Tagen auf See, begleiteten uns plötzlich Möwen, sie kreisten immer wieder über dem Schiff. Von Mannschaftsmitgliedern vernahm ich, dass es nicht mehr weit bis nach Dakar, dem ersten Hafen in Westafrika, sein würde. Nun kam auch bald die Küste in Sicht, aber es dauerte immer noch etwa zwölf Stunden, bis wir mit Lotsenhilfe im Hafen von Dakar anlegten.
Alles Freunde?
Sofort, nachdem das Schiff sicher am Kai lag, wurde die Gangway heruntergelassen, und die Behörden kamen an Bord, auch der Zoll erschien mit einigen Leuten.
Die Besatzung machte sich sofort daran, die Luken zu öffnen. Das Ladegeschirr musste richtig gestellt werden. Insgesamt wurde alles vorbereitet für das Löschen der für Dakar bestimmten Ladung, welches am nächsten Morgen beginnen sollte. Ich selbst hatte nach dem Anlegen nichts Besseres zu tun, als nur an der Reling zu stehen und an die Pier zu schauen.
Es war für mich einfach überwältigend, nur dunkelhäutige Leute zu sehen, z. T. doch recht ärmlich gekleidet. Am Kai war reger Betrieb. Viele Leute lungerten hier einfach nur so herum, wie es schien. Eine große, in eine Khaki-Uniform gezwängte männliche Person fiel mir irgendwann auf, die zielstrebig einen zweirädrigen kleinen Gummiwagen in die Nähe des Schiffes zog, ihn hier stehen ließ und die Gangway hoch kam.
Hier sprach er mit einem Offizier und ließ bald darauf eine Wurfleine von Deck hinunter an die Pier. Danach ging er wieder die Gangway herunter, befestigte einen Schlauch, der auf seinem Gummiwagen war, an der Leine, ging wieder an Bord und zog den Schlauch in die Höhe.
Hier schloss er den Schlauch an einer an Deck befindlichen Anschlussstelle an, ging wieder nach unten, schloss das andere Ende des Schlauches an eine Anschlussstelle an Land an und drehte dann ein Ventil auf.
Des Rätsels Lösung war denkbar einfach, es war der „Waterman“, ein schon seit Jahren in Johnson-Line-Uniform Dienst tuender Angestellter der Hafenbehörde, dessen einzige Aufgabe es war, die einlaufenden Schiffe mit Trinkwasser zu beliefern.
Am ersten Tag in Dakar war auch Postausgabe für die Besatzung. Leider war für mich noch nichts dabei, hatte ich doch wirklich noch keine Gelegenheit gehabt, meiner Mutter bzw. meinem Großvater zu schreiben und die Adresse der Reederei mitzuteilen. Dieses wollte ich aber unbedingt hier in Dakar erledigen.
Am nächsten Tag wurde es hektisch, schon vor dem Frühstück herrschte reges Treiben an Bord. Viele Schwarze kamen an Bord, bereiteten die Entladung vor, wie es schien. Viele gingen aber auch nach vorne unter die Back und tauchten erst mal nicht wieder auf. Wieder ein Rätsel? Durch einen meiner Kollegen wurde ich aufgeklärt.
Für die gesamte Lösch- und Ladezeit in Westafrika waren hier in Dakar, und das passierte jede Reise, 37 so genannte „Crew-Boys“ an Bord gekommen, 36 davon bewältigten die gesamten Lösch- und Ladegeschäfte und damit verbundene Decksarbeiten, der 37ste war der Wachmann, der, wie ich erfuhr, schon seit drei Jahren regelmäßig auf das Schiff kam. Er hatte eine Unterkunft in einem Decksraum des hinteren Windenhauses und war abends nach Arbeitsende der Arbeiter immer präsent in der Höhe der Gangway, um ungebetenen Besuch zu verhindern. Diese Maßnahmen waren schon seit Jahren hier in den Häfen so üblich.
Die Räumlichkeiten unter der Back auf dem Vorschiff, dienten für die nächsten zwei Monate als Schlafraum für die anderen Crew-Boys, hier kochten sie auch selbst. Alle Arbeiter waren nicht das erste mal hier an Bord, kannten sich mit den Gegebenheiten an Bord bestens aus und kannten auch die Besatzungsmitglieder, die nicht, wie ich, ihre erste Reise machten. Kurzum, man kannte sich.
Gesagt werden aber muss noch, dass für alle Einheimischen, die sich von nun an länger hier an Bord aufhalten würden, das Betreten der übrigen Räumlichkeiten der Besatzung streng verboten war. Warum diese Anordnung bestand, wurde mir nur zu deutlich vor Augen geführt. Ein Mannschaftsmitglied erzählte mir von abenteuerlichen Diebstählen in früheren Zeiten, und auch der Koch wusste vom Verschwinden einiger gekochter Hühner zu berichten. Wie er sagte, seien sie bestimmt nicht durch das geöffnete Bullauge der Kombüse entflogen. Auf jeden Fall war ich gewarnt. Trotzdem sollte es später zu einer seltsamen Begebenheit kommen, für die ich eine einfache Erklärung hatte.
In Dakar lagen wir nur wenige Tage. Dann ging es zum nächsten Löschhafen, vorbei an einer Anlegestelle, wo unglaublich hohe Berge von gestapelten Bettgestellen aus Metall lagen, eine nicht zu schätzende Menge. Uns wurde erzählt, dass die dreiteiligen einfachen Metallbetten schon vor Monaten hier abgeladen worden waren und für eine Hilfsorganisation bestimmt seien, aber bisher habe sich nichts getan.
Dicht unter der Küste fahrend ging es zum nächsten Hafen, Conakry, hier wurde nur kurz Station gemacht. Einen Tag lang entluden die mitfahrenden Crew-Boys die für diesen Hafen bestimmte Ladung. Auffallend war die große Anzahl von „Verwandten“ der Crew-Boys, die hier, wie auch in den folgenden Häfen, immer wieder an Bord kamen, und jeder brachte was mit, was die Angehörigen mit zu anderen Verwandten mitnehmen sollten.
Mir fiel erst hier ein unförmiges Gestell auf, welches an der Backbordseite vorne über das Vorschiff hing, eine Art flaches Zelt, was über dem Wasser schwebte, befestigt an der Verschanzung des Vorschiffes. Des Rätsels Lösung war nicht schwer zu erraten. Nachdem den ganzen Tag lang die Crew-Boys sowie alle dunkelhäutigen Besucher, die sich auf dem Schiff aufhielten, immer mal hinter den flatterigen Planen verschwunden waren und anschließend immer etwas außenbords ins Wasser plumpste, war mir schnell klar, was es war, und es hatte auch an Bord einen Namen: „Shit House“. Dass im Hafen, wenn mit Backbordseite angelegt war, jeder, der sich unten an der Pier aufhielt, alles beobachten konnte, störte hier keinen.
Читать дальше