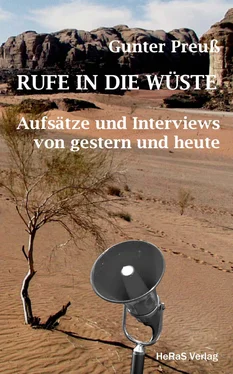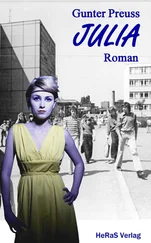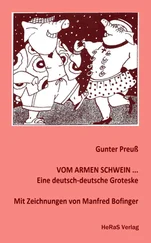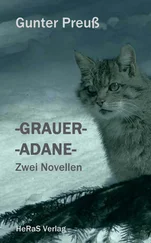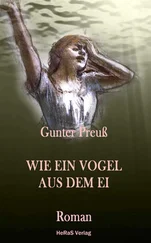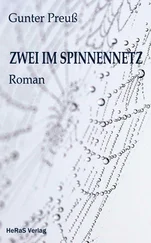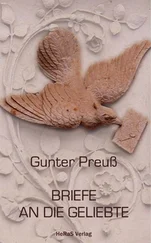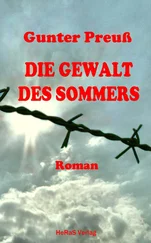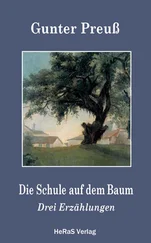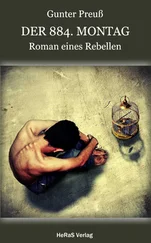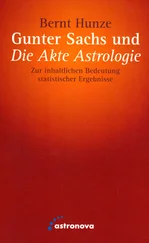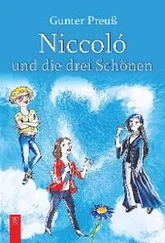Das Ziel einer sozialistischen, gar kommunistischen Gesellschaftsordnung sehe ich in der Annäherung an den uralten Menschheitstraum von Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wie schwer der zu realisieren ist, auch wenn die gesellschaftlichen Voraussetzungen geschaffen sind, haben wir schmerzlich erfahren müssen. Ich denke, die Zeiten sind endgültig vorbei, in denen wir glaubten, über Nacht aus dem Chaos eines Weltkrieges in ein Paradies, das sich Kommunismus nennt, eintreten zu können. Es ist ja der Weg des Suchers, den wir gehen müssen, ein langer, ein unebener Weg, den noch keiner vor uns gegangen ist. Inzwischen hat sich mir eine neue Frage aufgedrängt: Wie bewege ich mich auf ein Ziel zu, ohne dabei mich selbst und das Ziel zu verlieren? Es ist also nicht allein das „Wohin?“, das uns beschäftigt. Dem „Wohin?“ ist ja die Frage „Wie hinkommen?“ immanent. Das ist eine Frage der Moral und Ethik. Es darf uns nicht jedes Mittel recht sein, das Ziel zu erreichen, da muss schon das eine dem anderen entsprechen. Sonst verlieren wir an Glaubwürdigkeit, verletzen Vertrauen und verlieren letztendlich unser Ziel aus den Augen.
Wir leben in einer bis in ihr tiefstes Inneres gespaltenen Welt, in einer Welt voller Gegensätze, von denen die schärfsten immer wieder ihre Unversöhnlichkeit beweisen. Wir befinden uns im Existenzkampf - und müssen doch menschlich bleiben, so haben wir es selbst festgeschrieben. Der politische Gegner ist in der Anwendung seiner Mittel oft nicht zimperlich, er fragt wenig nach Menschlichkeit, für ihn ist das Leben in erster Linie ein Geschäft, bei dem er Profit machen will. Welche Chance haben wir - als Sozialisten -, der Gewalt zu begegnen? Bleibt uns nur die Gegengewalt? Aus der Menschheitsgeschichte haben wir erfahren müssen, wie Gewalt eskaliert. Aber zeigen wir uns schwach, werden wir genommen und einverleibt.
Wir müssen also stark sein. Stark, indem wir die Völker der Welt gerade durch das Beispiel der Gewaltlosigkeit von der Kraft unserer Idee überzeugen, wenn wir sie auf den friedvollen Weg des Suchers holen, wenn wir Vernunft in die Welt zwingen. Diese mit konventionellen und Massenvernichtungswaffen bestückte Erde ist ein Grauen geworden, mit dem wir beängstigend ruhig – gleichgültig? - leben. Dabei brauchten wir dringend die in die Rüstung fließenden Milliardenbeträge, um die Probleme des Friedens zu lösen (Energiefragen, Umwelt, Hunger, Krankheit, soziale Gerechtigkeit ...). Es gibt keinen anderen Weg als den des Gesprächs. Und werden wir heute abgewiesen, müssen wir es morgen wieder versuchen. Und werden wir morgen nichts erreichen, dann beginnen wir übermorgen von neuem. Durch die saubere und konsequente Umsetzung unserer Idee vom Sozialismus, durch die Kraft der Vernunft müssen wir den politischen Gegner an den Verhandlungstisch zwingen.
Bei dem, was wir erreichen wollen und dem hohen Maß an Verantwortung, das wir dafür tragen, können wir uns keine Müdigkeit oder gar Gleichgültigkeit leisten. Es ist also auch ein ständiger Kampf gegen uns selbst, gegen Trägheit, Selbstgenügsamkeit, Unlust, Egoismus, Überheblichkeit und so weiter, gegen all die Schwächen, die uns Menschen, gleichgültig welcher Weltanschauung und welchen Glaubens, nun einmal eigen sind.
Du fragst nach dem Menschenbild in unserer Gesellschaft, nach der Moral des Einzelnen, wie es ihm gelingt, seine Verantwortlichkeit und Vernunft zu handhaben. Gibt es zwischen Individuum und Gesellschaft mehr Gegensätzliches oder Übereinstimmendes? Bei Buchlesungen und den anschließenden Diskussionen stelle ich dann auch solche Fragen. Wenn die Leute den Mut gefunden haben, offen zu antworten, höre ich immer öfter Meinungen, die zunehmende Fehlentwicklungen unserer zwischenmenschlichen Beziehungen benennen. Gerade von jungen Menschen bekomme ich dann zu hören: „Leute, die sozialistische Moral ignorieren und sich auf ihre Ellenbogen verlassen, und vor allem auch Heuchler kommen besser voran. Wenn ich mich an die überall proklamierten Verhaltensforderungen halten würde, wäre ich ständig in Schwierigkeiten. Da wird gefordert, ich soll als Sozialist ein aufrichtiger Mensch sein, der überall offen seine Meinung vertritt. Aber wenn ich mich so verhalte, stellt man mich ins gesellschaftliche Abseits und diffamiert mich als Außenseiter, Störenfried und Nestbeschmutzer, der dem Klassenfeind zuarbeitet.“ Hier sehe ich Schuld einesteils bei der Gesellschaft, die sich in ihrem Bestreben schnell voranzukommen zu sehr auf den äußeren Schein verlässt, als durch die offene Austragung der Widersprüche auf Reifung zu setzen, die dann auch Vertrauen und das Gefühl von Zugehörigkeit mit sich bringt.
Andernteils sehe ich auch Schuld beim Einzelnen, der ja mit seiner Haltung den Charakter der Gesellschaft mitgestaltet. Es ist leicht, sich hinter dem Wort Gesellschaft, das Behütetsein in der Gemeinschaft suggeriert, zu verstecken, als wäre sie eine gottgegebene Institution. Mit dem Verzicht auf Eigenverantwortung leite ich meine Entmündigung ein. Nun passiere was wolle, ich bin nicht daran schuld. Aber die Gestaltung einer sozialistischen Gesellschaft, wenn wir es denn damit ernst meinen, verlangt die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit. Kurz: Mir geht es um Selbstbesinnung und Selbstbestimmung, um das ständige „Training des aufrechten Gangs“, wie Volker Braun das so treffend benannt hat. Und um das den Leuten erstrebenswert zu machen, wünsche ich mir mehr allgemeines und spezielles Augenmerk auf das Sein, als auf den Schein.
Was also für ein Menschenbild wünschen wir uns, eingedenk dessen, dass es genügend Raum für Facettenreichtum lässt? Was sollte der Mensch für Eigenschaften haben, um in unserem Streben nach Menschlichkeit Gegenwärtiges bewältigen zu können? Sollte er wie Bulli ein praktisch veranlagter, kräftiger, robuster Mensch sein? Ein Durchreißer? Oder wünschen wir ihn uns wie Peter, sensibel, verletzlich, zweifelnd, das Große wollend und manchmal schon am Kleinen scheiternd? Einer, der beider Eigenschaften in sich vereint, wäre wohl ideal, aber für menschliches Zusammenleben, das aus Gegensätzlichem wächst, unmöglich. Wir müssen uns da schon für beide Menschen entscheiden. (Die Vereinfachung in Typen sei entschuldigt; sie soll nur zur Klarstellung des Problems dienen.) Es ist ja im Alltag leider so, dass der Sensible, der Zweifelnde als lebensuntüchtig gilt. Überall wird der Tüchtige herausgestellt. In der Schule ist das der mit den besten Zensuren, der das Frage- und Antwortspiel am besten beherrscht. Dabei braucht er sich für nichts wirklich zu interessieren, er muss nur fleißig auswendig lernen und schnell begreifen, welche Frage welche Antwort verlangt. Der andere aber, vielleicht begabter, der sich diesem erstarrten Spiel entzieht, weil er schon durch Interessen geprägt nach Inhalten sucht, wird zum Hindernis für einen Unterricht, in dem ein großes und flüchtiges Bildungsangebot zum schnellen Auswendiglernen zwingt. Er wird zum Träumer erklärt, man ruft ihn „Spinner“, etwas Kränkliches scheint ihm anzuhaften, man lässt ihn am Rand stehen oder geht ihm aus dem Weg. Wenn der junge Mensch, der anfangs nur interessiert war am Inhalt dessen, was ihm gelehrt wird, nun solche Reaktion der Gemeinschaft, in die hinein er sich ja sehnt, erfährt, wird er immer tiefer in die Isolation abgedrängt, die ihn nun vielleicht wirklich zum Spinner macht, vielleicht gar zum Gegner der Gemeinschaft, die ihn ausgeschlossen hat. So bilden wir uns Menschen heran, die viel zu früh wissen, was sie wollen (sollen), die bald nicht mehr in der Lage sind, sich selbst und ihre Umwelt produktiv in Frage zu stellen. Sie sind zwar universell einsetzbar, aber nicht befähigt, in die Tiefe, dem Ding auf den Grund zu gehen. Beide aber, der „Träumer“ und der „Praktiker“, der Orpheus wie der Herkules, sollten in der Gemeinschaft aufgehoben sein und dieselben Möglichkeiten und Chancen haben, denn sie bedingen einander bei der Bildung von Vernunft, die aus der Berührung von Gegensätzlichem entsteht.
Читать дальше