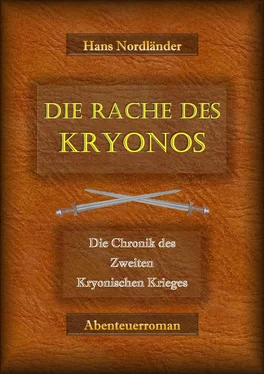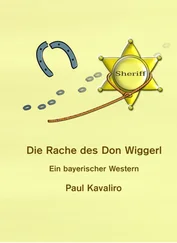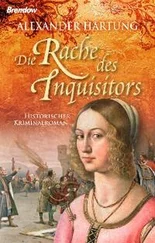Diese vier Wesen existierten bereits vor der jetzigen Schöpfung der Welt, und sie werden nach deren Wiederauflösung weiterbestehen. Sie sind – nach irdischen Vorstellungen – ohne Anfang und ohne Ende und haben das Entstehen und Vergehen unzähliger Welten erlebt. Die Luzengoi nur als unsterblich und ewig zu begreifen, hieße, ihr Dasein nicht zu verstehen. Ein Dasein, das zu verstehen kein irdisches Wesen in der Lage sein wird.
So kurz die Dauer eines Schöpfungskreislaufes für die Luzengoi auch ist, in jedem einzelnen haben sie ihre Aufgaben. Sie kümmern sich um den Aufbau, um den Erhalt und schließlich um die Auflösung der Welten. Sie sind die Baumeister des Weltalls. Und sie lenken die Geschicke der Lebewesen in der Schöpfung. Doch es sind nicht ihre Schöpfungen. Die Luzengoi sind als Einzelwesen frei im Denken und Handeln, aber sie sind nicht unabhängig. Sie führen ihre Aufgaben unter den Anordnungen eines übergeordneten, noch unbegreiflicheren Wesens aus. An dieser Stelle jedoch wird die Realität vollkommen unfassbar, und es empfiehlt sich, zu den Luzengoi zurückzukehren.
Eine der Aufgaben der Luzengoi war die sichere Aufbewahrung des Achôn-Tharéns über einen vorgegebenen Zeitraum. Es war nicht das erste Mal, doch wenn die folgenden, unvermeidbaren Ereignisse ein gutes Ende fänden, sollte es das letzte Mal sein.
Dieses Mal war der Zeitraum auf eintausendfünfundachtzig Erdosjahre festgesetzt worden. Auch wenn das für seine Bewohner eine halbe Ewigkeit bedeutet hatte, so dauerte es für die Luzengoi nur ein Augenzwinkern – wenn sie lidgeschützte Augen hätten.
Diese vier Hüter wussten, dass die Zeit der erneuten Freilassung des Achôn-Tharéns gekommen war. Sie hätten auch nichts dagegen unternehmen dürfen. Gleichmäßig verteilt standen sie außerhalb des Verlieses. Dieser Umstand lässt jedoch nicht auf die Größenverhältnisse schließen. Ihre Sinne durchdrangen den Raum und erfassten die Anwesenheit des Achôn-Tharéns. Hier war es gestaltlos. Es hatte seine feurige Kugelform verloren und seine feinstoffliche Ausdehnung erfüllte den ganzen Raum des Verlieses. In dieser Gestalt war ihm all seine Macht genommen, ohne dass es seiner Vernichtung anheimgefallen war, denn das hatte nicht geschehen dürfen.
„Der Augenblick ist gekommen“, hörten die Luzengoi die lautlos gesprochenen Worte Akzalois. „Das Achôn-Tharén muss erneut befreit werden. Die Zeit seiner Hut ist vorüber.“
„Ein unvermeidbarer Schritt zur Herstellung der alten Ordnung“, bestätigte Aihudir.
„Unvermeidbar, gewiss, aber wird er dieses Mal die Entscheidung bringen? Erwarten wir nicht, dass es der Endgültige sein wird“, zweifelte Alduhim.
„Darüber ein Urteil zu fällen, wäre verfrüht“, sagte Adbenazai. „Und wäre ein Urteil möglich, hätte es dann überhaupt einen Sinn, weiterzumachen, wenn es abschlägig ausfiele? Nicht einmal wir können vorhersehen, wie es dieses Mal ausgehen wird.“
„Das ist wahr“, gab Alduhim zu. „Aber die Vergangenheit lässt wenig Raum für Hoffnung.“
„Dieses Mal sind andere Mächte im Spiel. Viele Handlungen und Ereignisse beeinflussen die Zukunft. Wie es dieses Mal auch endet, die Folgen tragen nicht nur wir, aber die Auswirkungen für andere werden bedeutender sein, im Guten wie im Bösen.“
„Das ist wahr“, meinte Adbenazai. „Und doch kann Zweifel kein Maß für unser Tun sein, darf es auch nicht.“
„So sei es dann. Lasst uns tun, was vorherbestimmt ist“, entschied Akzaloi. „Stellen wir die Verbindung her.“
Die vier Luzengoi begannen, ihre Geisteskräfte zu einer Kraft zu verschmelzen. Wie sie einst das Verlies geschaffen hatten, so lösten sie es nun wieder auf. Allmählich zog sich die schwach glimmende Kugel innerhalb des Raumes zwischen ihnen zusammen, um sich in dessen Mitte in einem Punkt zu konzentrieren. Während das Gefängnis schrumpfte, nahm seine Helligkeit zu. Die Leuchterscheinung wurde deutlicher, immer stärker ihre Strahlung und schließlich war das Achôn-Tharén wieder zusammengefügt. Der Raum des Verlieses, dessen schimmernde Mauern die Wächter aus dem Achôn-Tharén selbst erschaffen hatten, verschwand. Bläulich pulsierend und eine unterschwellige Bedrohung ausstrahlend, schwebte es zwischen den Luzengoi, den vier Lichtgestalten, umgeben von der tiefen Schwärze der Unendlichkeit. Dann verblasste die blaue Kugel und in dem Maße, wie es wieder in die irdische Welt hinüberging, wurde sie in der Dimension der Luzengoi schwächer, bis sie schließlich daraus verschwunden war.
In der vollendeten Schwärze, die das Achôn-Tharén umgab, blinkten plötzlich unzählige Lichtpunkte in unterschiedlichen Farben und Größen auf, bunte Nebel wurden sichtbar und seltsam geformte Spiralen. Der irdische Weltraum.
Zwischen den Sternen und scheinbar aus dem Nichts entstand eine winzige blaue Kugel, und ohne lange an ihrem Platz zu verharren, setzte sie sich mit irrwitziger Geschwindigkeit in Bewegung. Sie kannte ihr Ziel, und nichts konnte jetzt noch verhindern, dass sie es erreichte. Geradlinig flog sie auf einen kleinen Verband von Himmelskörpern zu, bestehend aus zwei Sonnen, einem erdähnlichen Begleiter und dessen Mond. In wenigen Tagen würde sie Erdos erreichen. Des Achôn-Tharéns Herr hatte gerufen und sein Ruf war ein Befehl.
2. Auftrag aus dem Jenseits
Miesmutig folgte ein Reiter der endlosen Straße durch die Grauen Berge. Seit seinem frühen Aufbruch am Morgen dieses Tages hatte ihm ein wütendes Unwetter zugesetzt, es wollte einfach nicht von seiner Seite weichen. Jedes Mal, wenn es schwächer zu werden schien, war es nach kurzer Zeit umso heftiger über ihn hereingebrochen mit Sturm, Regen, Blitz und Donner. Die kurzen Unterbrechungen kamen dem Reiter wie ein Atemholen vor, bevor es sich dann umso unbändiger austobte. Fast schien es, als wollte ihn das Wetter zur Umkehr bewegen. Wäre sein Vorhaben nicht von so außerordentlicher Bedeutung gewesen, hätte er sich vielleicht sogar geschlagen gegeben, aber sein Auftrag erlaubte keinen Aufschub. Es war jetzt später Nachmittag, und wenn er diesen letzten Anstieg geschafft hatte, wartete ein sicherer Unterschlupf auf ihn.
Vor zwei Tagen hatte er Thorafjord, die Hauptstadt des Seenlandes, mit einem geheimen Auftrag verlassen, und Pferd und Reiter hatten nur selten gerastet. Die wenigen Stunden der Nachtruhe hatten sie in einer der geheimen Vorratshöhlen zugebracht. Diese Höhlen lagen gut verborgen entlang des alten Heerweges, den er benutzte.
Der Reiter war als Abgesandter seines Königs in einer Angelegenheit unterwegs, die, so hofften beide, mit einer Annäherung zwischen dem Seenland und Lysidien endete. Nur eine kleine Anzahl enger Vertrauter des Königs wusste von diesem Vorhaben. Kaum einer am Hofe des Herrschers wäre nicht dagegen gewesen, und manche hätten versucht, den Erfolg des Unternehmens zu vereiteln. Der letzte Krieg war noch in zu guter Erinnerung und die Abneigung gegen die Lysidier groß. Daher musste der Reiter heimlich die Stadt verlassen und, um kein Aufsehen zu erregen, allein. Es kam seinem Auftrag sehr entgegen, dass er am ersten Reisetag nur selten jemandem unterwegs begegnet war, und in seinem Waldläufermantel und unter dem breiten Hut wäre er kaum erkannt worden, falls tatsächlich ein Bekannter unter ihnen gewesen wäre. Kein einziges Mal hatte der Reiter angehalten, um mit irgendwem Worte zu wechseln. An diesem zweiten Tag schien er sogar der einzige Reisende in den Grauen Bergen zu sein.
Die Umstände seines Auftrages zwangen ihn zur Eile. Zwar hatten sich die Vorfälle an den nördlichen Grenzen des Seenlandes noch nicht als ernst erwiesen, aber die Lage drohte sich zu verschlechtern, seit immer öfter die dämonischen Bestien, nicht selten im Verband mit Uranen, gesichtet worden waren, die die Grenzen heimlich zu überschreiten versuchten. Vereinzelt waren sie von Felsgnomen unterstützt worden, was ungewöhnlich war, da Felsgnome und Uranen gemeinhin als verfeindet galten. Die Bestien wurden von den Felsgnomen sogar bis aufs Blut gehasst, hatte man bisher angenommen. Deshalb war diese Beobachtung umso besorgniserregender. Dass der seenländische König die Lysidier um Beistand gegen einen erstarkenden Feind bitten wollte, machte seinen Auftrag heikel.
Читать дальше