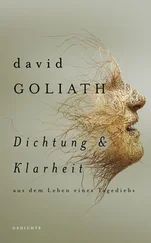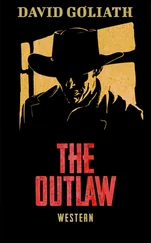Gemächlich schritt er auf seinen Schreibtisch zu. Die Blicke des ungebetenen Gastes verfolgten ihn. Er strich mit der Hand über den Tisch und am Brieföffner vorbei. Dann setzte er sich mit einem Stöhnen, als habe er stundenlang harte Arbeit verrichtet.
Lustig fühlte sich so überlegen, dass er Lena den Weg aus der Tür freigab. Sie hätte einfach hinaus und weglaufen können. Er hätte sich nicht aufgerappelt, um ihr hinterher zu laufen. Sie war ihm einerlei.
»Sind Sie verstummt?«, fragte Ludwig in lautem Tonfall.
Lena schüttelte schnell den Kopf. Das Geräusch, das sie dabei mit dem Gaumen und etwas Ausatemluft stoßweise fabrizierte, erinnerte an ein unausgesprochenes Nein . Der Lichteinfall von der offenen Tür erleuchtete eine Gesichtshälfte von ihr. Die andere blieb im Halbschatten.
Als Ludwig Lustig wieder ihren Bauch anstarrte, fiel sein Blick kurz auf die Stelle, wo er das Goldgarn versteckt hielt. Lena befand sich lediglich einen halben Schritt davon entfernt. Er wurde stutzig. Seine Hand legte sich unweigerlich auf den Griff des Rohrstocks, der noch an seinem Gürtel baumelte.
»Wenn Sie noch weiter meine Zeit stehlen und nicht unverzüglich mit der Sprache rausrücken, warum Sie hier sind, muss ich grob werden, befürchte ich, Frau Mayerz.«
Erneut fiel sein Blick auf die geheimnisvolle Holzbohle. Sie schien unverändert zu schlummern.
Kurz bevor Lena etwas sagen wollte, vernahm sie einen stechenden Geruch, der den Raum plötzlich füllte. Herbes Moschusparfüm. Wie ein wildes Tier aus dem Wald, das hier sein Revier markierte. Auf ihrer vormals beleuchteten Gesichtshälfte war nur noch Dunkelheit. Jemand stand in der Tür. Aber sie traute sich nicht, zu der Silhouette zu blinzeln. Stattdessen fixierte sie Lustig mit ängstlich geöffneten Augen.
»Wer ist das?«
Lena hörte eine merkwürdige, kratzige Stimme. Und die Tür wurde verschlossen. Zu allem Überfluss spürte sie die Anwesenheit eines dritten Mannes, der zusammen mit dem anderen in der Dunkelheit des Raumes verweilte. Sie bekam Panik. Ihre Knie schlotterten und sie konnte sich nur schwer auf den Beinen halten. Sie war offenbar zu tief in des Teufels Spinnerei vorgedrungen.
»Nur eine kleine Hure, die mich erpressen will«, war sich Lustig sicher. Er konnte sich zwar nicht daran erinnern Magdalena Mayerz benutzt und beschmutzt zu haben, aber Bestandteil seiner Fantasien war sie des Öfteren gewesen. Er zuckte mit den Schultern. Bei der Vielzahl an Huren war es nur eine Frage der Zeit, bis er eine unbeabsichtigt unterschlagen würde.
»Sollen wir uns darum kümmern?«, fragte einer der Männer aus der Schwärze der Kammer.
Lena schmeckte Eisen. Blut. Ihr Blut. Sie hatte sich vor lauter Körperspannung in die Unterlippe gebissen.
»Entschuldigen Sie die Störung«, presste Lena apathisch und monoton hervor. »Ich komme später wieder.«
Als sie sich umdrehte und zur Tür torkelte, stellte sich ihr einer der Schattenmänner entgegen und versperrte ihr den Weg.
»Moment«, tönte Lustig argwöhnisch. Er schaute auf die Holzbohle, die seinen gestohlenen Reichtum bedeckte. Als Lena darüber gelaufen war, hatte es kein Knarzen gegeben. Jemand musste sich daran zu schaffen gemacht haben. Er erhob sich flink und stellte sich hinter die schweißgebadete Schwangere. Auch sein Gewicht brachte die Bohle nicht mehr zum Knarzen. Etwas stimmte nicht und das hatte mit dieser Frau zu tun, war er überzeugt.
Lena war umstellt. Ihre stockende Stoßatmung kam ihrem angeschlagenen Kreislauf nicht zugute. Sie fühlte wie sich eine Ohnmacht anbahnte. Und sie konnte es nicht verhindern. Was mit ihr und vor allem mit ihrem ungeborenen Kind geschehen würde, lag nicht mehr in ihrer Macht.
Max begrüßte den Häuptling der Polizeidirektion, Gordon Godot, dermaßen herzlich, wie es sich für einen Bittsteller gehörte, ohne anmaßend zu klingen oder gar unverfroren. Obwohl Impertinenz genau die Form der Begrüßung gewesen wäre, die er diesem Heuchler gerne an den Kopf geworfen hätte. In einer Spiegelwelt, einem Paralleluniversum, hätte er das ohne zu zögern getan.
»Max Mayerz. Schön, dass Sie ihrem Vater folgen. Er war ein großartiger Polizist«, eröffnete Godot gönnerhaft.
Max’ Vater war zwar Ordnungshüter gewesen, aber bei seinem eigenen Sohn hatte sein Helfergen versagt. Er hatte Max die Schuld am Tod der Mutter gegeben und war nie darüber hinweggekommen, dass sie ihr Leben geben musste, um einem Bengel das Leben zu schenken. Diabetes und Dirnen waren daraufhin die Begleiter auf seinen letzten Metern bis zum Hinterwandinfarkt.
Den stümperhaften Kopfverband von Max und etwaige verletzungsbedingte Einschränkungen überging Godot, denn er kämpfte um jeden Mann. Gesetzeshüter waren schlecht bezahlt, schlecht ausgebildet und schlecht ausgerüstet. Letztlich bildeten sie nur die Zielscheibe für besser bezahlte, besser ausgebildete und besser ausgerüstete Verbrechersyndikate. Er konnte sich selbst nicht erklären, warum überhaupt noch jemand den Beruf machen wollte, war aber froh, verzweifelte Trottel wie Mayerz zu finden, die bereitwillig als Kanonenfutter herhielten.
Weil er glaubte, Max wie eine Spinne im Netz einwickeln zu müssen, ihn zu umgarnen, es ihm schmackhaft zu machen, damit dieser nicht das Weite suchte, verstrickte sich Godot immer weiter in den alten Geschichten, die Max’ Vater noch erleben durfte, wo Revolverhelden mit dem Stern auf der Brust auf staubigen Straßen im Duell schneller ziehen mussten oder romantische Verfolgungsjagden auf dem Pferd ausgefochten wurden. Nebenbei holte er aus, um Dienstmarke und Pistole von einem kürzlich ausgeschiedenen Anwärter aus seiner Schublade vor Max’ malmenden Kiefer zu knallen, bevor sich die Hexe Hocapontas bei der Nadelprobe in den Inquisitor verknallte.
Max interessierte das herzlich wenig. Er hörte zwar nur mit halbem Ohr hin, die Erkenntnis kam aber trotzdem: manchmal hilft auch keine Limonade.
»Melden Sie sich morgen bei Wachtmeister Walter Wolfram zum Dienst«, beendete Godot seine Ausführungen.
Das blutige Laken mit der undefinierbaren Masse entsorgte Max im Metallkübel vorm Haus. Der zyanotische Hautschwamm, das schleimige Fruchtgewebe und das viele Blut brannten sich in seinen Schädel. Soetwas hatte er noch nie gesehen. Soetwas wollte er nie wieder sehen.
Als er nach Hause gekommen war, lag Lena in der Küche. Sie weinte, hielt sich den Bauch und blutete stark, nicht imstande einen klaren Satz zu formulieren.
Über 35 Wochen hatte Lena ihr Kind in sich getragen und nun ist es ihr geraubt worden. Was Max zu Gesicht bekommen hatte, war lediglich die Nachgeburt. Doch konnte ein Mann ohne medizinischen Hintergrund im Schockzustand keinen Unterschied zwischen einer Nach- und einer Fehlgeburt erkennen. Zudem war es ohnehin irrelevant. Seiner Frau wurde Leid angetan. Etwas war passiert mit seinem Kind. Etwas Grausames.
Schwerer Regen prasselte auf das Dach, während Blitze die Nacht für einen Bruchteil erhellten, bevor Donner das Geschirr im Schrank zum Klappern brachte und den Boden zum Beben. Alle paar Minuten zuckte die nächste Entladung durch die stürmische Schwärze zwischen Sonnenuntergang und -aufgang, gefolgt vom tosenden Schwingen der Luftmassen.
Eine gefühlte Ewigkeit lagen Max und Lena inzwischen auf dem kalten Fußboden in der Küche. Er presste sie fest an sich. Obwohl sie mehr als nur Blut und Tränen verloren hatte, schlief sie völlig erschöpft. Ihr Brustkorb hob sich kaum. Sie atmete sehr flach. Max starrte ab und an krampfhaft auf ihren Oberkörper, um festzustellen, ob sie noch am Leben sei. Manchmal hielt er einen Finger unter ihre Nase, damit er den kurzen Lufthauch ihrer Ausatmung spüren konnte. Ein fremder Duft haftete an ihr. Dieser war aber so schwach, dass Max ihn kaum wahrnahm. Aus dem Bauch heraus würde er diesen als Moschus definieren. Ganz sicher war er sich nicht.
Читать дальше