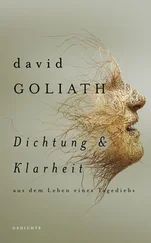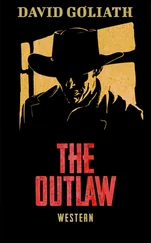David Goliath - Mina über den Wolken
Здесь есть возможность читать онлайн «David Goliath - Mina über den Wolken» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Mina über den Wolken
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mina über den Wolken: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Mina über den Wolken»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Mina über den Wolken — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Mina über den Wolken», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
David Goliath
Mina über den Wolken
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel David Goliath Mina über den Wolken Dieses ebook wurde erstellt bei
Haftungsausschluss Haftungsausschluss Fiktiv.
Kai Kaktus
Jürgen
Peter
Sex
Dresscode
Hausaufgaben
Liebesbrief
Charly
Kündigung
Kai
Trolley Dolly
Stefan
New York City
Papa
Impressum neobooks
Haftungsausschluss
Fiktiv.
Kai Kaktus
»Es ist aus.«
Kais Schlussstrich hallt durch meinen Kopf, wie das Echo von klackernden High Heels im 360° gefliesten Vorhof der Hölle. Dabei bevorzuge ich doch flache Schuhe. Der Rest ist verstummt. Nur das schallende Klackern kehrt immer wieder – dieser eine Satz aus seinem Mund. Dieser Satz, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe.
»Es ist aus.«
Tinnitus.
»Es ist aus?«, frage ich verdutzt. Meine Gesichtszüge müssen erstarrt sein. Schockgefrostet, in dem Moment, wo ich die Lawine auf mich zurasen sah.
»Ja«, antwortet er kühl, trocken, fast schon distanziert. Als wäre ich ein Klient, den er verteidigen müsste, obwohl er weiß, dass ich was ausgefressen habe. Als angehender Anwalt hat er gelernt, einen dicken Panzer um sich zu legen, damit er objektiv bleiben kann. Diesen Panzer zeigt er mir gerade. Ich kann diesen nicht durchdringen, ich kann nicht zu ihm vordringen. Das Gesagte ist in Stein gemeißelt. Kai kann nicht von seiner Meinung abgebracht werden. Das weiß ich aus den Konflikten, die wir schon hatten.
Er verschwindet ohne weitere Worte im Nebenzimmer und lässt mich mit der Taubheit allein. Das Urteil ist gefällt. Empathie ist ein Luxus, den er sich nicht leisten will.
Ich laufe ihm hinterher, doch die Tür trennt uns, weil er sie schließt. Er schließt sie nicht ab. Aber das Türblatt wird zur Mauer, die ich nicht passieren kann, egal was ich sage.
In meiner Verwirrung suche ich die versteckte Kamera, Publikum oder eine Ringschachtel, die mich aus dem Tief ganz nach oben katapultieren soll. Ich rede mir ein, dass es ein derber Spaß ist, damit ich noch empfänglicher für die Erlösung bin – die Vermählung. Doch nichts geschieht. Mir will nicht einleuchten, was da eben geschah. Wo ist der Scheinwerfer, der mich in Szene setzt? Wo ist das Licht, das mich führt? Ich sehe nichts, doch ich bin geblendet. Ein helles Rieseln vor meinen Augen. Diffus. Chaotisch.
Aus dem Nichts.
Oder?
Was war passiert, dass er mich so abweisend abweisen kann?
Das verflixte siebte Jahr. Es hat uns erwischt. Es hat mich erwischt. Kalt erwischt.
Unter Tränen verlasse ich unsere Wohnung und das Haus. Ich weiß nicht, ob es Tränen der Erleichterung, des Schmerzes oder der Freude sind. Es fühlt sich taub an. Ich klammere mich an die wenigen Dinge, die ich auf die Schnelle zusammenklauben konnte. Eine kleine Kiste gefüllt mit Habseligkeiten, von denen ich denke, dass ich sie akut brauche: meine Kapselkaffeemaschine, ein kleiner grüner Kaktus und das halbe Badezimmer (Make-up gegen den Breakdown, Bürsten und Kämme, Lappen und Schwämme, Haarspray, Deodorant und mein rotes Haarband, Parfumflakons und Tampons, Zahnbürste und Zahnpasta, Feuchttücher und Abschminktücher, Körperlotion und Anti-Schuppen-Shampoo, Epilierer und Rasierer, Pinzette und eine Gratispackung Gurkengesichtsmaske).
Meine Klamotten hole ich später. Oder ich lasse sie holen, oder er soll sie mir bringen – ein letzter Freundschafts dienst. Erneuter Träneneinschuss. Der Kaktus bekommt etwas Wasser ab.
Warum ich diesen kleinen, amerikanischen Stachelstrauch in der Eile eingepackt habe, kann ich gerade nicht nachvollziehen. Genau genommen ist es Kais Gewächs. Ich habe mich zwar darum gekümmert, sonst wäre es verkümmert, aber Kai hat ihn gekauft, einen sonnigen Platz dafür ausgesucht (das Küchenfenster) und jeden Morgen gegrüßt. Ein Ritual, wie er sagte. Vielleicht hat mich mein boshaftes Unterbewusstsein dazu getrieben, seinen Kaktus zu stibitzen. Vielleicht will ich ihm damit etwas nehmen, weil er mir etwas genommen hat – Sicherheit, Rückhalt, Geborgenheit, Liebe. Womöglich brauche ich das kleine Grün als Übergang vom Beziehungsmensch zum Single. Ein kleiner Begleiter, der mich an die Turbulenzen erinnert, denen man als Paar ausgesetzt ist. Sinnbildlich für die Aufs und Abs, zwischen den Dornen ist es weich, manchmal auch haarsträubend.
Vor dem Haus warte ich darauf, dass jemand die Tür hinter mir aufreißt – außer Atem – und mich in den Arm nimmt, mir zuflüstert, dass es ein Schnellschuss war und mir die schwere Kiste abnimmt, um sie zusammen mit mir zurück in die Wohnung zu tragen.
Ich warte. Vergeblich.
Erschöpft würde ich mich jetzt gern in meinen mitschwingenden Lesesessel fallen lassen, doch das einzige Mobiliar, das ich in der kleinen Studentenbude finanziert habe, musste ich im Eifer des Gefechts zurücklassen. Wie hätte ich den Sessel die Treppen herunterhieven sollen? Und dann? Campieren auf dem Gehweg?
Ich muss an meinen, vielleicht, überstürzten Einzug denken. Von meinem Elternhaus im hanseatischen Lübeck zu diesem Kölner Kerl, den meine Eltern nicht mögen, in die kleine Großstadtwohnung voller Filmposter, Pizzakartons und FC-Schals. Ein Protest meines jugendlichen Ichs. Die Zicke zieht aus, raus in die Welt, zu einem Geißbock, einer Internetbekanntschaft. Ich wollte sagen: schaut her, wir lieben uns, er kümmert sich um mich, ihr könnt mir nicht mein Leben diktieren.
Jetzt kommt die Retourkutsche. Und meine Eltern würden mich daran erinnern, wie eindringlich sie mir damals davon abgeraten hatten, trotz seiner eingeschlagenen Juristenlaufbahn. Immerhin haben wir es bis ins verflixte siebte Jahr geschafft. Warum es zum einseitigen Bruch kam, weiß ich noch nicht. Ich muss es erst einmal verdauen, ehe ich mich mit dem Warum auseinandersetze.
Meinen Sessel hole ich mir später. Oder es kommt zum Tausch: Sessel gegen Kaktus. Den kleinen Stachelstrauch behalte ich solange als Pfand. Ich könnte mir auch einfach einen neuen Lesesessel holen, irgendwann, wenn ich wieder Lust auf dieses Möbelhausphänomen habe, wo expansionswillige Fünfziger ihren zweiten Frühling ausstaffieren, praktisch veranlagte Familienmütter und –väter nach robustem, günstigem Handwerk suchen, liebeshungrige Pärchen mit dem Maßband konfigurieren und mutige Singles noch mehr unnützes Zeug für ihre heillos überfüllten Refugien shoppen. Mein Kopf ist nicht aufnahmefähig für skandinavische Namen, Menschenmassen und Regalnummern. Mein Magen rebelliert gegen den obligatorischen Abschluss mit Ein-Euro-Hotdog und Automaten-Softeis.
Die schattenspendenden Birken im Zebramuster vor dem Mehrfamilienhaus in der dichtbebauten, zugeparkten Einbahnstraße in Köln-Lindenthal empfangen mich freundlich. Kinder tollen auf dem kleinen Spielplatz ein paar Meter weiter, der eine Nische in die Reihe von Parkplätzen schlägt, während sich ein paar Mütter mit Hidschab mehr um ihre Handys als um ihre Plagegeister kümmern, die sich gern gegenseitig tyrannisieren. Neben schallenden Telefonaten mit fremder Zunge tönt Kindergeschrei durch die Straßen und wird an den lückenlosen Häuserfassaden verstärkt. Eine Handvoll Kinder hört sich so an wie eine Horde hungriger Hyänen, die kreischend umherspringen.
Kalte Luft trocknet meine Tränen. Durch den Kanal, den die Häuserschlucht schafft, zieht der Wind eine Schneise. Die Böen halten auf mich zu, brechen an meiner Statur und säuseln mir ins Ohr. Ich kann sie nicht verstehen, genauso wenig wie die Mütter im Hidschab oder Kai. Alle sprechen in einer Sprache, derer ich nicht mächtig bin. Ich fühle mich plötzlich verloren. Eine Million Menschen in Köln, doch ich fühle mich einsam.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Mina über den Wolken»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Mina über den Wolken» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Mina über den Wolken» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.