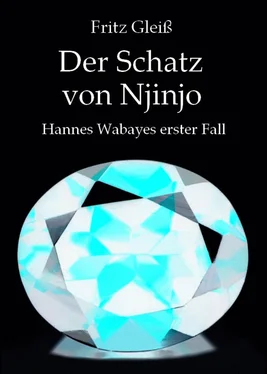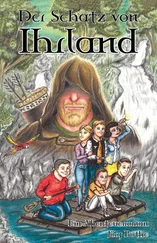Zunehmend wird die Gebirgslandschaft am östlichen Straßenrand nun steiler. Dunkel und undurchdringlich türmen sich am Horizont die Usambara-Berge mit ihren Jahrmillionen alten Regenwäldern auf, während das weite Land rechts von uns immer trockener und heißer wird. Stundenlang fahren wir am Rande der Hochebene durch eintönige Savanne, auf der sich immer wieder kilometerweit alte Sisalplantagen ausbreiten. Hin und wieder kreuzen wir die Eisenbahnschienen der Tanga-Bahn, die die Deutschen vor hundert Jahren zwischen dem Hafen am Indischen Ozean und ihren geliebten Usambaras bauten, um die Sisal-Fasern abzuholen. Nach vier Stunden schließlich stoppt der Fahrer seinen Bus zum Mittagessen in Korogwe.
Später, im Küstenflachland, wird die Luft immer stickiger und der Verkehr zunehmend dichter. Ab und zu passieren wir noch ein paar gewaltige Baobabs, bald dann nur noch kleine Akazien und dicke Felsbrocken. Weder die Klimaanlage noch die aufgezogenen Fenster sorgen jetzt noch für Erfrischung. Unbeeindruckt von der Hitze, vom heulenden Motorlärm, den engen Sitzen und vom Kindergeschrei, dösen die meisten Fahrgäste seelig vor sich hin. Kurz hinter der großen Kreuzung in Chalinze stoppt der Bus noch einmal etwas länger an einer Wiegestation. Sofort umschwirren uns Dutzende kleine und große Händler, die mehr oder weniger hoffnungsvoll Sandalen, Kugelschreiber, Zeitungen, Getränke und Menues feilbieten: Eier, Hühnchenteile, Obst und Nüsse, frisch geerntete Zuckerrohrstückchen, Maiskolben, süße Snacks. Um mich abzulenken, versuche ich, die Informationen zu ordnen, die ich bislang zusammen habe.
Gesichert scheint: Finn Schutte sucht die Hinterlassenschaft seiner Vorfahren, die die an einem Fluss im Süden des tansanischen Festlands 1916 vergraben haben. Am zehnten August 1916 hat Schuttes Großvater einem Bekannten einen Brief aus „Luisenthal“ geschickt, das hatten Hatten wie auch Sarah der Datumszeile entnommen. Kurz darauf war der Deutsche samt Frau und Stammhalter von den Engländern vertrieben worden.
Sarah hatte herausbekommen, dass niemand aus der Familie bis heute auf die Farm zurückgekehrt war, um das Versteck zu leeren. Das könnte bedeuten, dass die vergrabenen Sachen nur einen geringen Wert haben. Was aber sucht Schutte dann hier? Der mzungu wird doch kaum eine so teure Reise machen, ohne wie ich von Gold, Elfenbein, vielleicht ein paar Münzen und Familienschmuck zu träumen; Sachen, denen neunzig Jahre in modriger Erde nichts anhaben konnten. Theoretisch kann es sich natürlich genauso um Verderbliches gehandelt haben: Um Papier, Felle, Zucker, Salz oder gar Kokosfett. Dieser unappetitliche Gedanke verdirbt mir augenblicklich die Stimmung.
Doch die Kardinalfrage – wo liegt der Schatz begraben? – lässt sich durchs Nachdenken nicht klären, dazu muss ich Schutte auf den Fersen bleiben. Der Name „Luisenthal“ und das Brief-Datum sind zwar gute Anhaltspunkte, um den Fundort einzugrenzen. Dazu werde ich in Dar es Salaam ein bisschen herumforschen müssen. Aber das reicht nicht. Ohne direkten Kontakt oder zumindest indirekte Hilfe des mzungu werde ich nur schwer eine Antwort darauf finden, wo exakt die Deutschen Siedler lebten und ihren Schatz vergruben.
10. Hannes kommt kaum hinterher
Als ich endlich in Dar es Salaam am Ubungu Bus Terminal ankomme, ist es stockfinster. Wir hatten unterwegs unsere Panne gehabt, keine Stunde vor der Stadt. Statt Plattfuß einen Getriebeschaden, der nach sechs Stunden und viel Hämmern notdürftig behoben war. Der riesige Busbahnhof liegt im Dunkeln, nur Autolichter huschen herum. Wieder mal die Rechnung nicht bezahlt, liest man jeden Tag. Direkt gegenüber liegt das Kraftwerk und die Zentrale des staatlichen Stromkonzerns, die legen dann einfach den Hebel um. Aber auch in den angrenzenden Straßen scheint jegliche elektrische Beleuchtung ausgefallen: kein Strom, kein Licht. Es ist noch nicht mal zehn Uhr abends und Tansanias Vier-Millionen-Metropole spielt toter Mann. Die Nacht ist fast so schwarz wie unterm Mangobaum in Moshi, trotz der abertausend Menschen und Autos um mich herum. Keine fünfzig Meter reicht die Ahnung, dahinter liegt gähnend der Großstadtdschungel. Wie soll man sich hier bloß zurechtfinden?
Beim Aussteigen aus dem Bus rennt eine der mitreisenden Frauen wie von der Tarantel gestochen auf und davon –um das letzte Taxi noch zu kriegen? Sah eher aus wie Flucht. Dieses Phänomen panisch davonstiebender Frauen auf unseren Bahnhöfen habe ich früher schon beobachtet. Meist scheint es ihnen nur darum zu gehen, so schnell wie möglich aus dem Blickfeld der Mitreisenden – der Männer? – zu verschwinden. Sarah hat mal erzählt, sie sei auf ihrer bislang einzigen Bahnreise vor Jahren, als es noch den Nachtzug von Moshi nach Dar’ gab, gleich viermal aggressiv sexuell belästigt worden. Mitten unter Menschen, niemanden kümmerte das. Nie im Leben aber hätte sie einen der Polizisten, die die Zugfahrt begleiteten, um Hilfe gebeten – für Vergewaltigungen seien auch die Bullen allgemein bekannt. Könnte es sein, dass das keine weibliche Panikmache ist?
Honni hat mir die Adresse ihrer Bekannten aufgeschrieben, bei denen ich „garantiert“ für ein, zwei Nächte unterkommen könne. Im diffusen Licht einer Gepäckraumleuchte kann ich ihren Zettel gerade noch entziffern. Das Haus liegt in Temeke, weit entfernt im Süden, in einem Vorort, der nur mit einem Sammeltaxi der grünen Linie, per daladala , zu erreichen ist. Honnis Bekannte hätten sogar ein mobile , mein Chip aber ist seit Wochen leer. Was würde es auch nützen sie anzurufen? Abholen würden die mich sowieso kaum können oder wollen.
Zum Glück war ich schon einmal hier und weiß, dass ich zu den daladalas nur über die große Kreuzung rüber muss. Ich muss auch nicht rennen. Daladalas gibt’s genug, sicher wartet meines schon auf mich. Doch dann wird und wird der kleine Toyota-Bus nicht voll. Mittlerweile gibt’s auch wieder Strom, fahles Licht überzieht jetzt das Gelände, besser als nichts. Laufend treffen drüben Busse aus allen Landesteilen ein, die letzten vor Beginn des Nachtfahrverbots, das seit Jahren für alle Überlandstrecken gilt. Schlag auf Schlag füllen sich nun auch die letzten Sitze. Um kurz vor Mitternacht schließlich bin ich an der Davis Corner, der Ecke im Stadtteil Temeke, von der Honorata gesprochen hat. Nirgends ein Licht, nirgends Straßenschilder, keine Laternen an den ungeteerten Straßen rundum, kein vorbeirumpelnder Autoscheinwerfer, nur ab und zu der Schein eines Feuers oder einer Petroleumlampe aus einem der Höfe. Ich zähle die Häuser ab.
Nach einigen Minuten wähne ich mich vor dem Haus, das mir meine Tante nannte, bergauf bis über die Schienen, dann rechts das zehnte, nah bei der Schule. Ich klopfe. Nichts rührt sich. Nochmal schlage ich gegen die Tür, diesmal lauter, rufe grüßend „ hodi ?“. Immer noch nichts. Jetzt gehe ich ein wenig zur Seite, um an einem Fensterladen zu pochen. Im selben Moment strahlen mich von drei Seiten Taschenlampen an. Mir bleibt die Spucke weg.
„Was machst du da, ey?“, blökt mich eine kräftige Männerstimme an. „Einbrechen, wie? Das haben wir hier aber gar nicht gern. Jungs, holt schon mal Reifen und Benzin!“
„Was wollt ihr denn? Ich bin ein Freund des Hauses!“ Panik steigt in mir auf: Die wollen mich doch nicht etwa lynchen!? Dar es Salaams Bürgerwehren sind im ganzen Land berüchtigt. Sie patrouillieren nicht nur nachts, aber vor allem dann, vollkommen unkontrolliert. Wer ihnen als vermeintlicher Täter in die Hände fällt, hat schlechte Karten. Die Gruppe von Männern um mich herum wächst schnell bedrohlich an. Auch von drinnen kommen jetzt Geräusche: klägliches Bellen und anschwellende Rufe.
Читать дальше