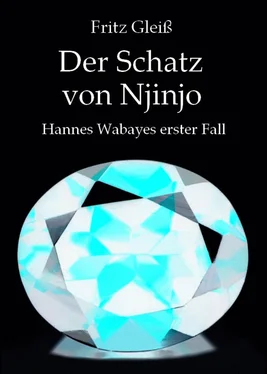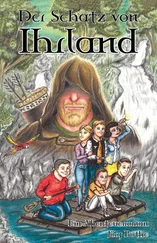Honorata ist zum Busbahnhof mitgekommen, um die Fahrkarte zu kaufen, sie kenne die Preise: „21.000 Shilling, keine Rupie mehr!“, natürlich aus meiner, seit gestern Abend nicht mehr ganz so leeren Tasche. Säuberlich hat sie die Summe in ein Vokabelheft eingetragen. Sie selbst fährt erst nach Silvester wieder an die Küste. Jetzt schickt sie mich zur Familie einer Bekannten in Temeke, bei der ich die ersten Nächte unterkommen könne.
Beim Einsteigen holt mich der Alltag ein. Nicht nur, dass der Bus innen weit weniger komfortabel ist als äußerlich versprochen – Dreier- statt Zweiersitze, Kopfteile verdreckt, Fernseher und Klimaanlage defekt –, sondern auch der Fahrer und seine zwei Ticketabreißer scheinen auf Krawall gebürstet. Sie haben sich abgesprochen. Eben noch 21.000, kostet der Platz in ihrem Bus plötzlich fünf Tausender extra: „Feiertagszuschlag“!
Vor Wut platzt mir sekundenlang der Kragen. „Gauner! Halsabschneider! Betrüger!“, alles, was mir an Schimpfworten einfällt, prasselt auf die Männer nieder. Schimpfen soll ja gut für die Psyche sein. Einen Moment lang glaube ich, ich hätte sie mit meiner Tirade überrumpelt. Meinen Plänen förderlich ist der Wutausbruch aber leider nicht. Die Kerle fackeln nicht lange. Sie zerren mich wie einen Betrunkenen aus dem Bus, versetzen mir zwei Ellenbogenstöße in die Nieren und lassen mich hinter einer kleinen Bretterbude einfach fallen. Als ich wieder zu mir komme, stehen zwei Rücken wie eine Wand vor mir, sodass ich die Augen lieber gleich wieder schließe. Kurz darauf sehe ich, wie weiter hinten der mzungu in meinen Bus einsteigt und sich die Türen schließen. Dann rollt er davon, und die zwei Rücken sind verschwunden.
Bloß nicht noch mehr Ärger jetzt! Schließen wir das Kapitel Detektivspielen einfach ganz schnell ab. Ich hab ja glücklicherweise noch einen anderen, ehrbaren Beruf, auch wenn der nicht viel einbringt, als Moshis schlechtest bezahlter Wirtschaftsberater. Noch hat mich das Abenteuer Schutte doch kaum etwas gekostet! Nur mein Fahrgeld, das will ich zurück.
Honorata aber, die das Drama mit den Schaffnern beim Weggehen beobachtet hat, ist kämpferischer. So schnell mag sie nicht aufgeben und sich die Chance entgehen lassen, Geschäftsführerin der ersten tansanischen Schatzsucherfirma zu werden. Besessen von der Idee, den mzungu zu verfolgen, hilft sie mir wieder auf die Beine. Dann fragt sie gar nicht erst, was denn passiert ist, sondern baut sich mit ihrer kräftigen Statur sofort vor dem Schalter auf, an dem wir die Fahrkarte kauften. „Ihre Kollegen haben meinen Freund hier aus dem Bus geschmissen! Völlig grundlos! Entweder sie verschaffen ihm sofort einen Sitz im nächsten Bus, oder ich bin in zwei Minuten bei der Polizei!“
Der Bursche hinterm Tresen wirkt tatsächlich eingeschüchtert. Vor der Polizei haben hier alle Angst, sie ist grundsätzlich teuer, oft brutal und selten unparteiisch. Freiwillig traut sich da kaum jemand hin, schon gar kein mittelloser Fahrgast. Honorata aber wirkt derart entschlossen, dass der Ticketverkäufer ihr die Drohung abzunehmen scheint. Anstandslos streckt er mir eine neue Fahrkarte hin, ohne Zuschlag, und auch die zwei Rücken tauchen nicht mehr auf, bis ich im „Zwei-Uhr-Express“ an die Küste sitze – acht Uhr mzungu -time. „Express“, das heißt besonders schnell, oder? Mit etwas Glück könnte ich fast zeitgleich mit Schutte in Dar es Salaam eintreffen.
Die Straße führt an den sanft ansteigenden Hügelketten der Pare-Berge entlang und ist frisch geteert. Strahlend gelbe Linien weisen auf dem schwarzen Asphalt kilometerweit nach vorn. In der Zeitung stand, 250 Millionen Dollar aus Europa seien in den Ausbau des highways geflossen, dieser modernen Karawanenroute. Damit der Spitzenkaffee vom Kilimanjaro, den hier niemand trinkt, schnell nach Europa kommt. Auch nach Tanga, dem traditionellen Ausfuhrhafen, dauert’s jetzt keine zehn Stunden mehr. Endlich kann hier jetzt auch jeder so schnell rasen wie er will – so er denn ein Auto hat. Offiziell gibt’s zwar speed limits , selbstverständlich, doch anders als in den Ländern, aus denen unsere Autos kommen, nirgends Radarfallen. Eine Sendung im kenyanischen Fernsehen, das bis Moshi reicht, zeigte kürzlich Bilder, wie die Polizei in Europa Raser fängt: mit Blitzen, Infrarotkameras, Portraitfotos und futuristischen Rennwagen. Science-Fiction live!
Alle paar Kilometer liegt ein Wrack am Straßenrand. Meist ist es so arg zerbeult, dass keine Überlebenden zu befürchten sind. Mein Express-Bus rast mit 110 Kilometern pro Stunde über die Piste – der Tachostand wird laufend im Fernseher eingeblendet, in dem irgendein indischer Schmalzfilm plärrt. Schuttes Bus war zwar etwas klappriger, muss deshalb aber kaum langsamer sein. Je länger die Fahrt dauert, desto dringlicher wünsch ich ihm jede erdenkliche Panne hinterher – Plattfuß, Achsenbruch, Crash mit ´nem Zebra, Kolbenfresser, Motorexplosion –, anders gibt es keine Chance, dass unser Ein-Stunden-Abstand schrumpft. Bald rechne ich immer weniger damit, den mzungu noch einmal einzuholen. Stattdessen sauge ich die Landschaft in mich auf, die draußen an uns vorbeizieht. Vor den Bergen im Osten breiten sich riesige sattgrüne Felder aus, die erst vor wenigen Jahren angelegt wurden.
„Was ist das, Mama?“, fragt ein kleines Mädchen ihre Mutter, die seit der Abfahrt meinen ohnehin eng bemessenen Sitz von links bedrängt. „Da bauen Chinesen Reis an, Kindchen“, antwortet die mama . „Das sind Menschen von weit her, die hier mal gearbeitet haben.“
„Aber mit den Reisfeldern haben sie gar nichts zu tun“, mische ich mich ein. „Außer, dass sie uns das Reisessen beibrachten.“
„Das konnten wir nicht selbst?“ Erstaunt runzelt das Mädchen seine Stirn.
„Doch, aber wir kannten Reis ja gar nicht. Erst als ganz viele Chinesen zu uns kamen, um eine Eisenbahn zu bauen, lernten wir, wie schnell man davon satt wird“, erkläre ich ihr amüsiert.
„Heute essen wir Reis ja genauso oft wie matoke , früher gab’s stattdessen viel öfter posho “, fährt die mama fort.
„Warum gehören den Chinesen die Reisfelder denn nicht mehr?“ Das Mädchen wendet sich wieder mir zu.
„Heute sind es Menschen aus Japan, die solche Felder bezahlen. Sie verstehen auch was vom Reisanbau, vor allem aber verstehen sie viel von Geld.“
„Geld? Wieso braucht man dafür Geld?“
„Na ja, man muss zum Beispiel das Saatgut kaufen, Reisgras wächst nirgends hier bei uns von selbst. Und dann muss man ganz viel Wasser auf das Feld leiten, durch Rohre, Pumpen und Dämme. Auch die kosten Geld.“ Ich bekomme richtig Lust, mein Beraterwissen auszupacken. Endlich interessiert sich mal jemand dafür, wenn auch nur ein kleines Mädchen. Doch ehe es beginnt Spaß zu machen, ist’s schon vorbei. Abrupt wechselt das Mädchen das Thema. „Wie heißt du?“, fragt sie unvermittelt.
„Hannes.“
„Hunis? Was ist denn das für ein Name?“
„Hannes. Das ist deutsch, eine Sprache, die die Menschen nahe des Nordpols sprechen.“
„Aber wieso hast du einen so seltsamen Namen?“ Das Mädchen stürzt sich neugierig auf das neue Thema.
„Oh, das ist eine komische Geschichte. Meine Mutter hat sie mir erzählt. Als sie mich geboren hat, nannte sie mich Johannes, wie ein bekannter, uralter Jünger von Christus. Jahre später tauchte in Moshi ein mzungu auf, der bekannt war für irre laute, ewig gleiche Musik. Ständig dröhnten fremdländische Gesänge aus seinem Haus, meilenweit. Oft wiederholten sich die Songs, und manche waren so berühmt, dass auch meine Eltern sie kannten.
Als Kaishe, mein Vater, entdeckte, dass dieser mzungu Lieder spielte, die er selbst schon oft gesummt hatte, begann er, sich für den Fremden zu interessieren. Er machte sich bekannt und erfuhr den Namen des lauten Barden. Mit Vornamen hieß der Hannes, seinen Familiennamen erinnere ich nicht. Na ja, und seitdem haben erst Kaishe und dann alle anderen meinen Namen abgekürzt. Ehrlich gesagt, mir ist das auch lieber so.“ Unterdessen war das Mädchen auf dem Schoß seiner Mutter eingeschlafen.
Читать дальше