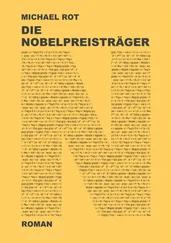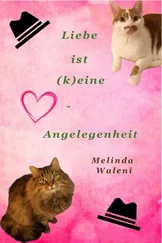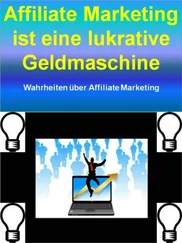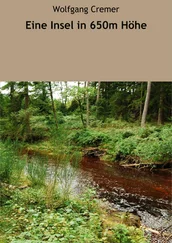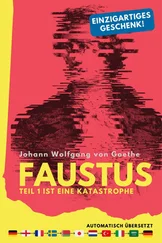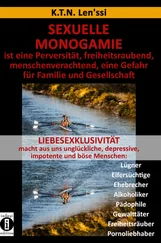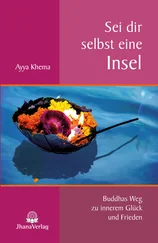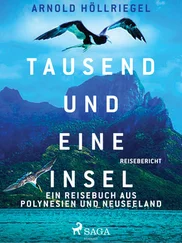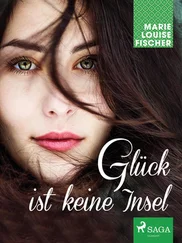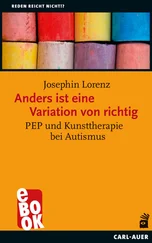Wie die meisten Ordnungssysteme in Japan ist auch die Benennung von Etagen einfach und logisch. Man beginnt dort zu zählen, wo man hineingeht – und dort ist »eins«, es gibt kein Erdgeschoß. Nach oben geht es weiter mit 2, 3, 4, ... und nach unten mit -1, -2, -3 ...
Im alten Japan gab man auch das Alter eines neugeborenen Kindes mit »1« an, 365 Tage später wurde es »2«. Obwohl diese Zählung seit 1902 offiziell abgeschafft ist, verwenden ältere Leute sie bis heute. Die Großmutter meiner Frau rühmt sich gerne ihres hohen Alters – und erschwindelt sich mit der traditionellen Zählung noch ein Jahr dazu.
Obwohl die japanische Bezeichnung von Stockwerken denkbar einfach ist (und auch in den USA, Russland und China üblich), kann einem gelernten Wiener die Gewohnheit doch Streiche spielen. Immer wieder bin ich versucht, bei der Angabe »1. Stock« eine Treppe hochzulaufen. Ich bin auch schon im Erdgeschoß in den Aufzug gestiegen, um die Taste »1« zu drücken, verwundert, dass nichts geschieht. Das ist aber ohnehin nur möglich, weil man die Zahlen im Lift wenigstens lesen kann.
Ziffern und Zahlen nicht lesen zu können, war eine der Erfahrungen, auf die ich nicht eingestellt war. Aber warum sollte eine Sprache mit völlig anderen Schriftzeichen nicht auch eigene Zahlenzeichen haben? Die arabischen Ziffern haben sich zwar weitgehend durchgesetzt, kanji -Zahlen findet man aber häufig auf Speisekarten von Restaurants und bei der Preisauszeichnung in manchen Geschäften.
In japanischen Aufzügen sind die Stockwerke in arabischen Zahlen angegeben, aber daneben gibt es immer – für Ausländer nicht identifizierbare – Tasten zum Offenhalten und Schließen der Türen. Ersteres als Geste der Höflichkeit, Letzteres als Zeitersparnis – jede Sekunde zählt. Eine ganz andere unlesbare Taste findet man in Bahnhöfen und U-Bahnstationen, wo Aufzüge oft nur zwei Haltepunkte haben, den sogenannten »homu-Knopf«. Wo aber ist »home«? Ist es der Bahnsteig oder der Ein- und Ausgangsbereich? Einmal fahren die Züge oben, ein anderes Mal im Keller. Wie soll ich denn wissen, wo der Lift beheimatet ist? Die Heimatadresse von Aufzügen ist aber noch die harmloseste Besonderheit japanischer Adressangaben.
»Ein anderer Planet«, wie meine Frau zu sagen pflegt. Das klingt beunruhigend; mit Recht. Orientierung stellt in Japan immer eine Herausforderung dar; und nicht nur wegen der Sprache.
In jedem anderen Land könnte man am Flughafen einfach ein Taxi besteigen, man könnte den Namen des Hotels nennen oder die Adresse, zu welcher man gebracht werden will, nötigenfalls in schriftlicher Form (was sich auch in Portugal empfiehlt). In Japan würde nicht einmal das zuverlässig funktionieren. Wer im Land des Linksverkehrs ein Taxi besteigt, sollte nicht nur das Ziel, sondern nach Möglichkeit auch den Weg dorthin recht gut kennen. Ins Hotel Ritz-Carlton, zum Hauptbahnhof oder zum Flughafen findet jeder Taxifahrer – vorausgesetzt, man kann ihm das Ziel verständlich machen. Jede andere, und sei es noch so genaue Adressangabe hat ihre Tücken und weist eine erstaunliche Verwandtschaft mit Venedig auf (und damit meine ich nicht das Wasser).
»Bezirk Tanimachi, Abschnitt drei, bitte«, sagte meine Frau, als wir ein Taxi in Ōsaka bestiegen.
»Wenn ich von Norden fahre, ist es gut?«, entgegnete der Taxifahrer.
»Ich denke schon.«
»Ist das schon in der Nähe von Ōsaka-Castle?«
»Es ist eigentlich schon fast bei Abschnitt vier.«
»Hier ist schon Abschnitt drei; wo soll ich fahren?«
»Vielleicht die nächste Straße rechts.«
»Rechts?«
»Ja, ich glaube – und dann bitte die zweite Straße links.«
»Es tut mir wirklich ganz besonders leid, ich bin ganz untröstlich, gnädige Frau, aber die zweite links ist unvorhergesehener Weise eine Einbahn in die andere Richtung.«
»Dann nehmen wir doch die nächste. Und dann zurück.«
»Bitte, gerne. Soll ich hier beim Supermarkt abbiegen?«
»Ich weiß nicht, ob das passt.«
»Dann nehme ich vielleicht die nächste Straße.«
»Jetzt sind wir aber doch zu weit.«
»Dann werde ich da vorne wenden.«
»Danke, wir sind schon da! Können Sie bitte neben dem Restaurant anhalten.«
Mit der Zeit habe ich auch verstanden, warum in unserem Hotel mein Wunsch nach einem Taxi immer mit dem Vorschlag quittiert wird: »Bitte gehen Sie doch vor auf die Hauptstraße. Dort fahren alle Taxis.« Was sollten sie auch sagen am Telefon? Bitte ein Taxi zum Hotel neben dem Restaurant?
Haben Japaner schon Schwierigkeiten mit der Orientierung, so kommt für den Fremden die Sprachbarriere noch erschwerend hinzu. Wer auf dem anderen Planeten völlige Unfähigkeit zu Kommunikation erwartet, ein Gefühl von Analphabetismus, Hilflosigkeit bei einfachsten Verrichtungen und plötzliche Vereinsamung, der wird nicht enttäuscht werden. So ungefähr müssen sich die Entdecker fremder Länder gefühlt haben, wenn sie darauf angewiesen waren, sich in Gebärdensprache auszudrücken.
Nehmen wir nur einmal an, man hätte die Sprache der Bewohner erlernen können. Was möchte man wissen, was könnte man erfahren?
»Wo schlaft ihr gewöhnlich?«, würde ich also fragen.
»Gewöhnlich schlafen wir nicht, wir arbeiten.«
»Und wenn ihr doch einmal gerade nicht arbeitet? Wo verbringt ihr eure Zeit, mit eurer Familie?«
»Meist zu Hause.«
»Also doch. Und was ist das für ein Zu Hause?«
»Ich habe eine Eigentumswohnung in der Stadt.«
»??«
»Ist auf Dauer gesehen die günstigste Variante.«
Vielleicht ist dieser Planet doch nicht gar so anders, als ich dachte.
»Und wo ist die Eigentumswohnung?«
»Gleich neben dem Supermarkt.«
»Welcher Supermarkt?«
»Der neben meiner Wohnung.«
»Ich meine, wie heißt er?«
»Kohyō.«
»Gibt’s sicher viele in der Stadt.«
»Ich weiß nicht. Zweihundert?«
»Aha. Und wie finde ich dann deine Wohnung?«
»Komm mit, ich zeig sie dir.«
»Ja, aber wenn ich allein kommen will?«
»Warum willst du allein in meine Wohnung, wenn ich hier bin?«
»Nein, nicht jetzt. Aber wenn du zum Beispiel zu Hause bist, und ich dich besuchen will.«
»Ja, bitte komm!«
»Aber wie finde ich dorthin?«
»Ah, das meinst du. Ich hole dich von der U-Bahn ab. Ausgang Nummer 14.«
»Wunderbar, ich verstehe! Also ihr braucht eigentlich gar keine Adressen. Ihr trefft euch einfach bei einem Fixpunkt.«
»Ja, so machen wir das.«
»Na, dann komme ich dich morgen Nachmittag besuchen. Ist das in Ordnung?«
»Ja, das passt. Morgen Nachmittag also.«
»...«
» Sumima'sen , Entschuldigung noch. Wie heißt denn die U-Bahn Station?«
»Die U-Bahn Station. ... was hilft denn ein Name ... es ist ganz einfach ... vier Stationen von meiner Firma entfernt.«
»Deiner Firma?«
»Ja, wo ich arbeite. Gleich neben dem Drogeriemarkt.«
»Drogeriemarkt!?«
»Aber kein Problem. Wenn du es nicht findest, nimm einfach ein Taxi!«
Tatsächlich benötigt man beim japanischen System von Verabredungen und Terminen nicht unbedingt eindeutige Adressen. Es gibt sie, natürlich gibt es sie. Genauso wie in Venedig – aber wer hat dort schon je eine Adresse gefunden? Die Müllabfuhr jedenfalls nicht. Anders als im systemlosen Chaos Venedigs basiert das japanische System auf einer leicht verständlichen, aber wenig hilfreichen regionalen Unterordnung, vergleichbar der allgegenwärtigen menschlichen Hierarchie; eine Art japanisches Matrjoschka-System. Dem bürokratischen Zentralismus zum Trotz kann die Gliederung regional stark voneinander abweichen.
Bei unserem Hotel in Ōsaka sieht das zum Beispiel so aus:
Präfektur (Ōsaka-fu)
Stadt (Ōsaka-shi)
Читать дальше