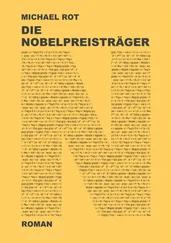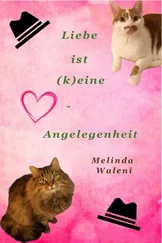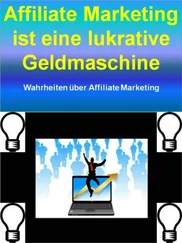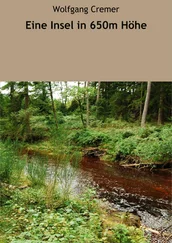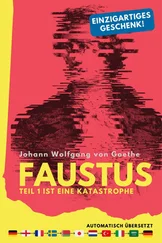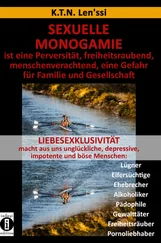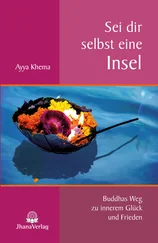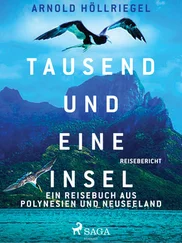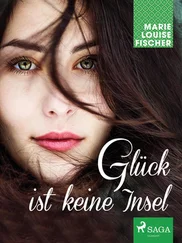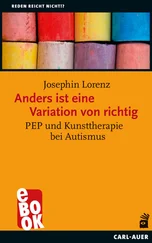Ah! Eureka! Tabereru ist ein Potentialis und heißt »man kann (es) essen«, folglich war das eine Frage ohne Partikel, also: »Kann man das essen?«
»Hai! tabereru« [Ja, man kann], antwortete ich, eine halbe Stunde zu spät.
Wie so vieles in Japan ist auch Japanisch nicht einfach eine andere Sprache, sondern eine andere Welt. Als Europäer ist man gewohnt, Sprachen auf einer gewissen Basis mit einander zu vergleichen, Strukturen zu übernehmen oder als bekannt vorauszusetzen. Grammatikalische Grundprinzipien ziehen sich wie ein Netz durch die europäischen Sprachfamilien; germanische, romanische oder slawische Sprachen haben jeweils viele Gemeinsamkeiten, bis hin zu gleichen oder ähnlichen Wörtern.
Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was einen in Japan erwartet, kann man bei ersten Kontakten mit Spanisch und Portugiesisch erleben.
Dem Taxifahrer in Lissabon blieb meine Aussprache von »Hotel Baixa« rätselhaft; erst das Vorweisen meiner schriftlichen Notiz überzeugte ihn vom Ziel der Fahrt. Die Ausspracheregeln zu lernen wäre noch kurzfristig möglich gewesen; ähnlich wie am Spanischen ist aber auch am Portugiesisch die fast 800-jährige Besatzung durch die Mauren nicht spurlos vorüber gegangen. Mehr als 1000 Wörter des alltäglichen Wortschatzes entstammen dem Arabischen. Aber…
... aber bei etwas näherer Betrachtung erweisen sich auch Spanisch und Portugiesisch in grammatikalischer Hinsicht als europäische Sprachen, und vor allem… – man kann sie lesen.
Und Japanisch?
Die Erinnerungen an meine ersten Kontakte mit dieser Sprache sind furchterregend. Heute liebe ich sie – die Sprache, nicht die Erinnerungen. Ich liebe es, Japanisch reden zu hören, und ich habe den Mut gefunden, es in alltäglichen Situationen zu benützen. Die unendliche Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Japaner täuscht mich gelegentlich sogar darüber hinweg, dass das Ergebnis meiner Sprachversuche nur in den seltensten Fällen korrekt ist.
Selbstverständlich erwartet man Neuland, wenn man sich zum ersten Mal näher mit einer asiatischen Sprache auseinandersetzt. Natürlich ist einem bewusst, dass die Schrift grundlegend anders ist, und dass man vielleicht neue Formen der Lautgestaltung erlernen muss. Und auch wenn man ein Leben lang mit dem Auto rechts gefahren ist, kann man doch lernen, links zu fahren. So dachte ich. Schließlich stellt man aber fest, dass dieses Auto kein Lenkrad hat, kein Gaspedal und keine Bremse. Die Frontscheibe ist matt, man sieht nichts, man hat keine Ahnung, wo man sich befindet.
Die Geschichte der japanischen Schrift beginnt im 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, als man begann, die chinesischen Schriftzeichen kanji für die Darstellung des Japanischen zu übernehmen. Gleichzeitig entwickelte sich daraus eine zweite, eigenständige Schrift, das kata'kana . Während es etwa 20 000 (zwanzigtausend!) aus China übernommene kanji gibt, umfasst katakana lediglich 46 Zeichen. Nun enthalten Chinesisch und Japanisch zwar zum Teil ähnliche Laute, sind aber grundsätzlich verschiedene Sprachen. Das führte dazu, dass beinahe alle kanji zumindest zwei Lesungen aufweisen, nämlich eine sino -Lesung (also die ursprünglich aus China übernommene) und eine nomi -Lesung (eine in Japan neu entstandene). Weitere japanische Lesungen kamen im Laufe der Jahrhunderte hinzu, und so manches kanji weist bis zu sechs verschiedene Möglichkeiten der Aussprache und/oder Bedeutung auf.
Das japanische Bildungsministerium gibt heute einen Standard von 2500 kanji vor, die ein gebildeter Japaner beherrschen sollte. Also 2500 Zeichen mit durchschnittlich zwei bis drei verschiedenen Lesungen. Hinzu kommen die katakana -Schrift und hira'gana , die jüngste Schriftfamilie mit heute ebenfalls 46 Zeichen. Während bis ins 18. Jahrhundert katakana vorwiegend zur Darstellung von Bindeworten, Wortendungen und ähnlichem verwendet wurde, hat diese Funktion inzwischen hiragana übernommen. Katakana wird heute in erster Linie zur Schreibung von Fremdwörtern und ausländischen Namen verwendet, aber auch für japanische Namen – z. B. in Dokumenten, wo die Schreibung eindeutig sein muss. Besonders wichtige Hinweise können ebenso in katakana geschrieben sein wie Speisekarten oder Verbotsschilder.
Auch die lateinische Schrift findet unter dem Namen rōmaji Verwendung in Japan. Abgesehen vom Englischunterricht kann man sie auch zur Eingabe auf dem Smartphone und Computer verwenden, man findet sie als Geschäftsnamen und Werbeaufdrucke. Und natürlich wird sie zur Transkription des Japanischen in europäische Laute verwendet.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.