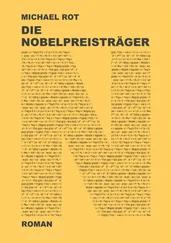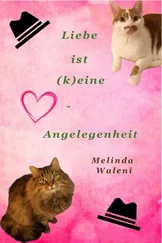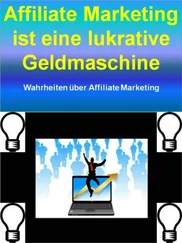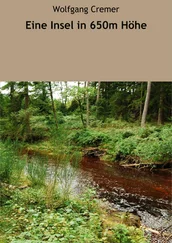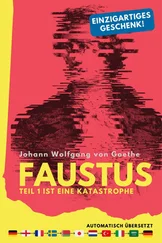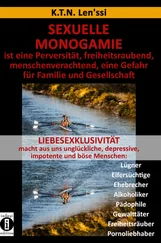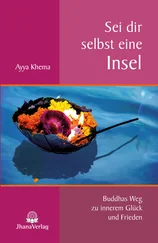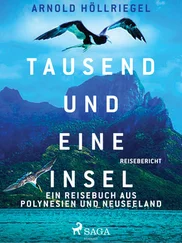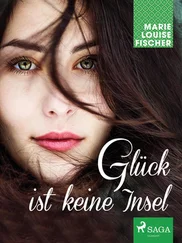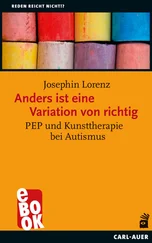Michael Rot - Japan ist eine Insel
Здесь есть возможность читать онлайн «Michael Rot - Japan ist eine Insel» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Japan ist eine Insel
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Japan ist eine Insel: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Japan ist eine Insel»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
"Ich unterrichte bis viertel sechs."
"Viertel vor sechs?"
"Nein, viertel nach fünf. Bin so um sechs zu Hause."
"Schön, dass du zum Sex zu Hause bist."
Die Ehe mit meiner japanischen Frau ist immer unterhaltsam, skurrile Missverständnisse prägen unseren Alltag. Humorvolle Episoden begleiten die Leser durch eine Geschichte, in der auch spannende Fakten über Japan nicht zu kurz kommen. Darüber hinaus herrscht in diesem Buch aber pure Subjektivität – gelegentlich auch die Meinung meiner Frau.
Japan ist eine Insel — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Japan ist eine Insel», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Heute lebt Japan als zugleich geschichtsträchtige und hochmoderne Kultur- und Industrienation in einem Zwiespalt zwischen dem Anspruch, international wirtschaftlich und politisch mitzumischen, und der Realität unüberwindlicher Grenzen; auf der einen Seite 6000 Kilometer Pazifik, gegenüber Südkorea und China, zwei Länder, die aus historischen Gründen gemieden werden. Im Norden der allerletzte Zipfel Sibiriens, und alles andere liegt weit dahinter, tausende von Kilometern entfernt. Und selbst im Zeitalter des allgegenwärtigen Fernsehens und Internets ist die große Mehrheit der Japaner vom Rest der Welt abgeschnitten, weil sie nicht oder kaum Englisch können. Alle wichtigen japanischen Medien sind von öffentlichen Geldern und vom Wohlwollen der Regierung abhängig; folglich gibt es so gut wie keine kritische Berichterstattung. Die Einwohner sind also auf jene Informationen angewiesen, die man ihnen zumutet. So hat selbst ein hochentwickelter und marktwirtschaftlich-demokratisch organisierter Staat Kontrolle über seine Bürger, die jener in diktatorischen Staaten nur unwesentlich nachsteht. Die scheinbar große Zahl japanischer Touristen in Europa ändert nichts an diesem Informationsmangel. Zum einen handelt es sich doch nur um einen sehr kleinen Prozentsatz der Bevölkerung, zum anderen bleiben solche Besuche zu oberflächlich, um Denkansätze zu motivieren. Essen, Baudenkmäler, Mozart, Sisi, der Eiffelturm und das Kolosseum bilden den Inhalt solcher Reisen, isoliert von Politik, Wirtschaft und gesellschaftlicher Relevanz.
Viele DDR-Bürger, die Westfernsehen empfangen konnten, wussten mehr über die Welt als ein durchschnittlicher Japaner mit Internetanschluss heute weiß.
Ebenso wie ich bis vor wenigen Jahren kaum Kenntnisse über Japan hatte. Als ich meine Frau in Wien kennenlernte, war ich – ganz im Gegensatz zu den meisten meiner Musiker-Kollegen – noch nie in Japan gewesen. Bereits bei meinem ersten Aufenthalt fiel mir jedoch auf, dass man als Europäer in Japan immer heraussticht, obwohl man zumindest in der Großstadt heute kein Aufsehen mehr erregt. Selbst in den Geschäftszentren von Tōkyō oder Ōsaka sind nur wenige nicht asiatische Ausländer zu sehen, sogenannte »Hochnasen« (4). Die Zahl der Touristen in Japan steigt zwar, es sind aber vor allem Chinesen und Koreaner, die meist unerkannt bleiben, solange sie nicht sprechen.
(4) Nach Auffassung von Chinesen und Japanern hebt sich eine europäische Nase höher aus dem Gesicht heraus, woher die von beiden verwendete, eher abwertend gemeinte Bezeichnung »hohe Nase« [jap.: »hana-ga takai« ] rührt. Ihre eigene Nase bezeichnen Japaner gerne als »niedlich« (oder meinen sie doch »niedrig«?).
Nun betrat ich also als Europäer zum ersten Mal ohne sprachkundige Begleitung ein japanisches Kaffeehaus und stellte mich in der Schlange an, um zu bestellen. Sobald mich die freundliche Dame hinter dem Tresen erblickte, weiteten sich ihre Augen, die ohnehin spärliche Farbe wich aus ihrem Gesicht. Ein Anflug von Panik machte sich breit, wahrscheinlich dachte sie:
»Hilfe, ein Amerikaner!«
Was sollte sie auch sonst denken? Die einzigen Weißen, die sie im japanischen Fernsehen ständig sieht, sind Amerikaner. Wirtschaftliche und politische Kontakte zu den USA beherrschen die Nachrichten, der Rest ist China, Korea oder Schweigen. Europa ist weit weg. So weit, dass es in den Köpfen kaum existiert.
»Hilfe, ein Amerikaner!«, dachte sie also. »Er wird jetzt sicher Englisch sprechen, und ich werde es nicht verstehen.«
Eigentlich wäre alles ganz einfach. Wörter wie »coffee«, »tea«, »hot« und »cold« versteht selbst eine japanische Verkäuferin; und alle Kassen zeigen die Summe auf großen Bildschirmen an. Es müsste also kein Wort gewechselt werden. Nun aber kam ein verrückter Europäer, der sich einbildete, sein Japanisch trainieren zu müssen, und sagte:
»Do'rippu 'kōhii-o hi'totsu one'gai shi'masu« [Ich hätte gerne einen Filterkaffee, bitte].
Das zu einem Fragezeichen mutierte Gesicht der netten Dame machte deutlich, dass die Botschaft nicht angekommen war. Wie auch. Die unverändert nette Dame kam gar nicht auf die Idee, das Gehörte könnte Japanisch sein. Sie hatte unverständliches Englisch erwartet, und was sie hörte, war für sie unverständlich. Ihrer Erwartungshaltung war voll entsprochen worden.
Japanern ist stets bewusst, wieviel Zeit und Mühe sie aufwenden mussten, die eigene Muttersprache zu erlernen und wie schwer sie sich schon mit ein paar Wörtern Englisch tun. Sie würden daher von einem Ausländer nie erwarten, dass er sich bemüht, Japanisch zu sprechen.
Schließlich sah ich vor mir eine Speisekarte liegen, deutete auf das Gewünschte, und sie sagte erfreut:
»Ah, do'rippu 'kōhii-o hi'totsu.«
»Hai« [Ja], antwortete ich – und dachte: Habe ich nicht genau das eben gesagt? Sie aber hatte mich nun ertappt, die Farbe kehrte in ihr Gesicht zurück, und mit leuchtenden Augen rief sie aus:
»Ah, 'nihon-go-o hanashi'masu-'ka?« [Ah, Sie sprechen Japanisch?]
»Su'koshi, su'koshi« [Nur ein Wenig], sagte ich sicherheitshalber, um weitere Fragen ihrerseits zu vermeiden. Ich wollte ja nur einen Kaffee bestellen, und nur darauf war ich sprachlich vorbereitet. Bloß kein weiteres Gespräch, das meine spärlichen Kenntnisse im Nu überfordern würde. Doch zu spät. Einmal des Japanischen überführt, war der Fluchtweg ins Englische abgeschnitten.
»??? ...?? ..., ??? ... mo-'ii-desu-'ka?« [.... ist das in Ordnung?]
»'Kekkō desu« [Nein, danke], antwortete ich unter Aufbietung von Lektion 5 in Band 1 meines Lehrbuches. Und werde wohl nie erfahren, was sonst noch hätte in Ordnung sein können.
Wer in Europa eines der zahlreichen asiatischen Lokale aufsucht, wird fast immer auch ein Angebot von Speisen in der sogenannten »Bento-Box« vorfinden. Diese Lunchboxen sind eine urjapanische Tradition; ganz und gar nicht japanisch ist jedoch die Idee, sie im Restaurant serviert zu bekommen. O-bentō entspringt eher dem klassischen Fastfood-Gedanken: Essen »to go«, zum Mitnehmen, allzeit bereit.
Dass der Inhalt dieser kleinen Wunderwerke japanischer Kochkunst in der Regel höchsten Ansprüchen gesunder Ernährung entspricht, lässt unsereinen mit europäischer und amerikanischer Fastfood-Erfahrung vor Neid erblassen. Eine typische bentō -Box enthält wie jede traditionelle japanische Mahlzeit gekochten Reis, gekochtes Gemüse, Fisch oder Fleisch (gegrillt oder gedünstet), eingelegtes Gemüse und nori (geröstete Algen). Kinder nehmen sie mit in die Schule, Angestellte ins Büro, Ausflügler zum Picknick, Reisende in den Zug und sogar Theaterbesucher ins Theater. Viele Boxen sind immer irgendwie unterwegs.
Es gehört allerdings zu den absoluten Tabus, seinen Schnellimbiss auf der Straße im Gehen oder stehend in der U-Bahn zu verzehren. Dasselbe gilt für den an jeder Ecke erhältlichen »coffee to go«, der in Japan eigentlich »coffee or go« heißen müsste.
Auch sushi zum Mitnehmen erfreuen sich großer Beliebtheit. Solche Boxen werden aber nicht bentō genannt und haben im Übrigen wenig Ähnlichkeit mit dem, was in europäischen Imbissbuden und Supermärkten angeboten wird.
Viele o-bentō werden zu Hause selbst zubereitet, zum Beispiel für Schulkinder. Die meisten werden jedoch von hunderten kleinen und großen Unternehmen täglich frisch in unzähligen Variationen produziert. Man kann sich unmöglich in Japan bewegen, ohne auf Schritt und Tritt auf sie zu stoßen; in jedem Supermarkt, den rund um die Uhr, 24/7 geöffneten »Convenience Stores«, an Straßenständen und Bahnhöfen, in der U-Bahnstation, und im Erdgeschoß jedes Kaufhauses.
Erdgeschoß, Rez-de-jardin, wie die Franzosen so schön sagen, Piano terra, ebenerdig – eben erdig. Was gibt es nicht für wunderbare Begriffe für die schlechteste aller Wohnlagen. Aber, nein: da gibt es ja noch das Souterrain und das Hochparterre. In Wien sind wir verschwenderisch, wir haben noch das Mezzanin (Halbstock). Zusammen mit den vier darüber gesetzten Stockwerken sind das sieben bewohnbare Ebenen. Und genau das ist der Clou. Die Wiener Bauordnung im 19. Jahrhundert erlaubte nur vier Stockwerke. Was aber nicht Stockwerk hieß, war auch keines.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Japan ist eine Insel»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Japan ist eine Insel» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Japan ist eine Insel» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.