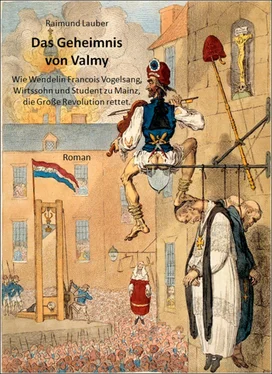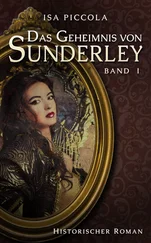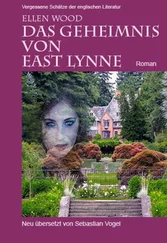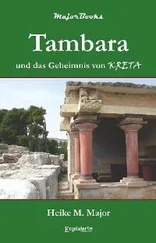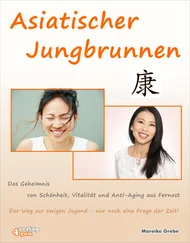Ich stand auf der Straße und wusste nicht wohin mit mir. Das Gespräch mit dem Buchhändler hatte mir mehr zu schaffen gemacht, als mir lieb sein konnte. Es hatte mich, und ich sage dies ohne jede Übertreibung, derart beunruhigt, dass ich mich schwer tat, meine Gedanken zu ordnen. Ein Kommilitone auf dem Weg zu den „Drei Mohren“ in der nahen Augustinerstraße, versuchte mich zu überreden, ihm beim Dämmerschoppen Gesellschaft zu leisten, aber ich winkte ab. Manchmal hilft es, sich jemandem anzuvertrauen, wenn man in Schwierigkeiten steckt und in einem guten Gespräch den Dingen wieder das rechte Maß zu geben, vielleicht auch einen guten Rat zu bekommen oder doch wenigstens ein paar tröstende Worte zu erhalten, aber dieser Weg war mir versperrt. Jedes Wort, das über die Ungeheuerlichkeiten bekannt würde, in die mich der Jakobiner eingeweiht hatte, zöge unabsehbare Folgen nach sich. Der einzige Mensch, dem ich mich hätte öffnen können, wäre Poggibonsi gewesen und der reiste, weiß Gott wo, in der Welt herum. Plötzlich fühlte ich mich sehr einsam. Im letzten Licht des Tages ging ich zum Rhein hinunter und starrte in das Wasser, bis es in der anbrechenden Finsternis langsam schwarz wurde. ‚Schwarz wie der Tod‘, ging es mir durch den Kopf. ‚Nimm dich zusammen, du Narr‘, meldete sich die Vernunft, ‚schließlich ist schwarz die Bedingung für Licht, so wie es nichts Gutes ohne das Böse, es keinen Gott ohne Teufel geben kann und Leben ohne den Tod nicht denkbar ist.‘ Das leuchtete mir ein und ich ging den Schritt, den mir die Vernunft gewiesen hatte. Demnach war der Mord am schwedischen König die Bedingung für die Rettung vieler tausender Soldatenleben, sowohl auf schwedischer wie auf französischer Seite. Der eine Tod gegen das Leben vieler Söhne, Brüder und Männer. Das war die klare Rechnung, die mir die Vernunft aufgemacht hatte und sie fügte noch ein weiteres, zwingendes Argument für den Mord an. Wenn ich die Perspektive wechselte und die Tat aus höherer, weltgeschichtlicher Warte betrachtete, wie man das schließlich von einem vernunftgeschulten, historisch denkenden Menschen erwarten durfte, dann würde der Meuchelmord an dem schwer verletzten schwedischen König zur Rettungstat für die große Revolution. Ruhm und Ehre warten auf den Vollstrecker, dient er doch dem Wohle der ganzen Menschheit. So drang die Vernunft in mich. Nur, aus meinen Nöten half sie mir nicht. In mir wohnte noch ein Anderes außer der Vernunft, das die älteren Rechte beanspruchte mich zu lenken. Ich nenne es meinen inneren Kompass, weil ich mir nicht sicher bin, ob Begriffe wie Gewissen, Herkommen oder Prägung es ganz umfassen. Jedenfalls hing mir mein frommes Elternhaus mit seiner bürgerlichen Weinstube zu sehr an, als dass ich der Vernunft hätte reuelos in die Kälte folgen können. Der hasszerfressene Sansculotte, der in der aufgehetzten Masse wollüstig seinen Rachedurst befriedigt, kennt keine hinderlichen Skrupel, für mich aber wäre die Verleugnung meines innersten Wesens ein tödliches Opfer. Besorgt fragte ich mich, was die Revolution wohl noch fordern mag. Vielleicht die vorsorgliche Auslöschung noch weiterer Menschen oder ganzer Gruppen, die, wie der Schwedenkönig, der Revolution gefährlich werden könnten. ‚Und wenn schon! Kleinigkeiten sind das, Nebensächlichkeiten in Hinblick auf das große Ziel alle Menschen in eine glückliche Zukunft zu führen‘, wies mich die Vernunft zurecht und höhnte, wären Alle so kleinmütig wie du, nichts würde sich zum Besseren wenden für deine Mitmenschen.‘ Das saß. Ich wusste nicht mehr ein noch aus. Wo war Poggibonsi? Nie hätte ich es mir träumen lassen, dass ich einmal solche Sehnsucht nach dem alten Mann haben würde.
4. Kapitel
Wie Wendelin Hauslehrer
des Bürgertöchterchens Sophie wird
und was er von ihr über Petits fours frais lernt.
Patocki hielt Wort. Drei Tage später konnte ich mein neues Quartier beziehen. Über einen Buchdrucker, mit dem er in geschäftlichen Beziehungen stand, hatte er mir ein schönes Zimmer im zweiten Stock des Hauses der angesehenen Konditorei Laun am Marktplatz besorgt. Bevor ich es bezog war es das Reich von Fritz, dem Sohn des Hauses gewesen. Man hatte alles so beibehalten wie er es bei seiner Abreise zurückgelassen hatte, als rechnete man in absehbarer Zeit mit seiner Heimkehr. Unter seinen Büchern fiel mir ein ziemlich zerlesenes Exemplar Rousseaus „Vom Gesellschaftsvertrag oder Prinzipien des Staatsrechtes“ auf. Ich warf einen kurzen Blick hinein und fand, dass Fritz, nach Art von besonders engagierten Lesern, Stellen, die ihm besonders wichtig schienen, unterstrichen oder mit Randbemerkungen versehen hatte. Einem zwischen die Seiten geklemmten Zettel mit einer Pariser Adresse schenkte ich keine Beachtung. Ich hielt ihn für einen Einmerker, als der er wohl auch diente.
Frau Meisterin Laun hatte sich ausbedungen, dass ich, zusätzlich zur Miete, ihrer jüngeren Tochter Sophie beim Erlernen des Rechnungswesens behilflich sei, soweit es einer künftigen Geschäftsfrau von Nutzen sein könnte. Unter den gegebenen Umständen blieb mir gar nichts anderes übrig, als auf ihre Bedingungen einzugehen. Sophie erwies sich als ein aufgewecktes Mädchen, das den schwierigen Weg vom Mädchen zur jungen Frau schon ein tüchtiges Stück gegangen, aber noch nicht ganz angekommen war. Als ich sie zum ersten Mal sah, war sie als Kind verkleidet, zu ihrem Schutz, wie ich annahm. Man hatte sie in ein weiß-rosa gemustertes Hängekleid mit Puffärmelchen gesteckt, dessen weit abstehender Saum gerade noch die Knie bedeckte. Darunter kamen weiße Pumphosen zu Vorschein, deren spitzenbesetztes Ende über den Knöcheln mit einem glänzenden, blauen Band gerafft war. Dazu verströmte sie den zartsüßlichen Duft der Backstube ihres Vaters, den sie, wie sie mir später gestand, nur zu gerne bei der Arbeit besuchte. Die Marzipanpüppchen, die Meister Laun kunstvoll für Hochzeitstorten fertigte, ähnelten allesamt Sophie. Selbst das zarte Rot ihrer Wangen vergaß er nicht den Marzipangesichtchen aufzulegen. Das brachte ihm nicht selten den Spott seiner Frau ein, die mehr ihrer älteren Tochter Klara zuneigte. Das mag vielerlei Gründe haben, einer davon ist sicher, dass Claire, wie sie seit ihrer Verlobung mit Leopold Hölzl, dem Vizekommandeur der Mainzer Stadtwache, genannt zu werden wünscht, ganz nach ihrer Mutter kam, die in ihrer Jugend als dunkelhaarige Schönheit galt. Auch dann noch, als der Schmelz der Jugend dahin war, ließ sich ahnen, was sie ihrer Ehe geopfert hatte, wie sie behauptet und wahrscheinlich auch glaubt. Damals, als ich bei ihr einzog, lugten ihre Haare schon graumeliert unter ihrer Haube hervor und Falten gaben ihrem hageren Gesicht ein strenges Aussehen, das nicht trog. Die Confiserie oder Patisserie, wie sie ihre Zuckerbäckerei auch gerne nannte, betrieb sie mit Fleiß und Umsicht. Ihrem wachsamen Auge entging nichts und wer in ihre Nähe kam, der konnte sicher sein, im Moment seiner Entdeckung mit einem Auftrag belegt zu werden. Widerspruch duldete sie nicht. Ihrem Geschäft bekam all dies sehr gut. Sogar der Hof zählte zu ihren Kunden. Ihr Mann dagegen, trat kaum in Erscheinung. Er vollbrachte seine kleinen Wunder im hinteren Teil des Hauses in der Backstube, die ihm Arbeitsplatz war und Refugium zugleich. Von alledem wusste ich bei meinem Wechsel zur Familie Laun natürlich noch nichts.
Martin hatte gelassen reagiert, als ich ihm unsere Wohngemeinschaft aufkündigte. Dann werde er jemand anderen bei sich aufnehmen müssen. Allein wolle er nicht wohnen, das wäre ihm zu teuer und im Seminar sei wegen der exilierten Priester nach wie vor kein Platz für ihn, war sein ganzer Kommentar. Keine Frage nach dem Warum und Wohin. Mir war es recht. Es enthob mich unangenehmer Erklärungen und giftiger Debatten, die ihnen unweigerlich folgen würden und so gingen wir auseinander wie Fremde.
Читать дальше