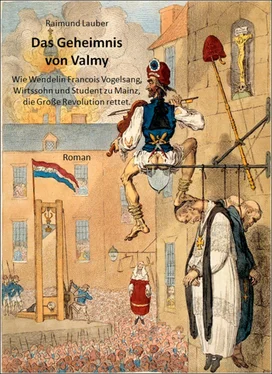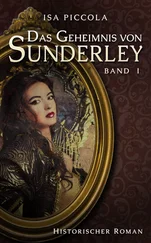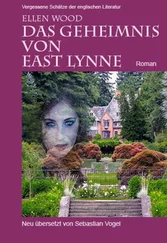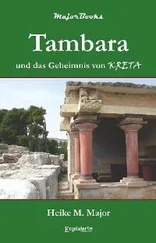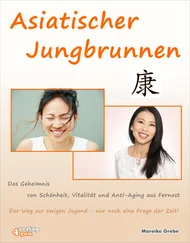3. Kapitel
Was Martin Kruttenschnitt über die Revolution
und die minervische Eule zu sagen weiß
und Wendelin das Gewissen schlägt.
Ich wartete bis Poggibonsi hinter dem Holztor verschwunden war, erst dann nahm ich sein Abschiedsgeschenk genauer in Augenschein. Es war keine gewöhnliche Börse, die er mir zugedacht hatte, sondern eine Wickelbörse, einer kleinen Mappe nicht unähnlich, wie man sie manchmal bei Reisenden finden kann. Sie war aus rötlichem gehämmertem Leder gearbeitet und wurde von zwei geschmeidigen, fest mit ihr verbunden Lederbändchen zusammengehalten. Als ich die Schleife löste und behutsam die Börse aufklappte, leuchtete mir golden ein kunstvoll ineinander verschlungenes Monogramm mit den Buchstaben WFV entgegen. So etwas Schönes hatte ich noch nie gesehen, geschweige denn besessen. Ich hob das Leder an die Nase und schnupperte daran. Es roch neu und kostbar. In drei Fächern steckten Zahlungsanweisungen von unterschiedlicher Höhe auf meinen Namen und in einem eingearbeiteten Täschchen klimperten Münzen. Poggibonsi hatte sich nicht lumpen lassen. Alles zusammengerechnet ergab es für einen armen Studenten ein nettes Sümmchen. „Sorgen ade! Bis wir uns wieder sehen wird viel Wasser den Rhein hinunter fließen“, jubelte ich und beschloss zur Feier des Tages meinem immer hungrigen Zimmergenossen eine kleine Überraschung zu bereiten. Die allgemeine Teuerung, unter der die Stadt durch die Flut der französischen Gäste litt, schreckte mich nicht davon ab, einen zweipfündigen Laib Brot, einen Ring geräucherter Wurst, eine dicke Scheibe haltbaren Käses und einen Liter vom heimischen Wein einzukaufen. Während ich die zwei Stockwerke zu unserer Bude hinaufkletterte, freute ich mich schon darauf, was Martin für Augen machen würde, wenn ich meine Köstlichkeiten, eine nach der anderen, vor ihm ausbreiten würde. Aber Martin war ausgeflogen und da es traurig ist alleine zu essen, beschloss ich zu warten, bis er zurück käme. Die geschenkte Zeit bis dahin nutzte ich, um die Börse genauer zu untersuchen. Außer den Zahlungsanweisungen fand ich noch eine handgeschriebene Anleitung, wie man einen Brief oder ähnliches, wenn es nicht zu voluminös war, in der Börse unauffindbar machen konnte. Meine Neugierde war geweckt. Mit Hilfe des Zettels machte ich mich Schritt für Schritt daran, das Versteck zu finden. Das forderte mir viel Geduld und noch mehr Fingergeschicklichkeit ab. Als ich das Geheimnis der raffiniert ineinander gehenden Klappen, Fächer und Falten durchschaut hatte, wurde ein Schlitz sichtbar, dessen Öffnung gerade groß genug war, um mit drei Fingern hineingreifen zu können. Ich brachte einen gefalteten Bogen zu Tage, ohne dass er Schaden genommen hatte. Als ich meinen Fund sorgfältig ausbreitete, lag ein Kupferstich des kurfürstlichen Lustschlosses Favorite zu Mainz vor mir auf dem Tisch. Le Rouge, der Künstler, hatte sich der Vogelperspektive bedient, um die verschwenderisch schöne Schlossanlage darzustellen. Auf der linken Seite war der Plan mit einer Legende versehen und eine freie Stelle am rechten, oberen Teil des Blattes enthielt eine Beschreibung der Gesamtansicht, alles in französischer Sprache. Ich vertiefte mich in die Ansicht, ging ein wenig in den Anlagen vor dem Rheinschlösschen spazieren, vorbei an der Thetis-Grotte und zur Orangerie hinauf. Raffiniert wechselnde Blickachsen boten immer neue Aussichten auf Brunnen, Grotten und Wasserspiele, liebevoll eingebettet in feinste französische Gartenkunst. Hier müsste man verweilen dürfen mit einem geliebten Menschen am Arm, in der Abenddämmerung eines Sommertages vielleicht. Stunden hätte ich so verträumen können, aber die Neugierde trieb mich den Bogen zu wenden. Da glotzte mir aus kugelrunden Augen eine kleine, nach antikem Muster stilisierte Eule entgegen. Die Abbildung maß nicht mehr als das letzten Gliedes meines Zeigefingers, war aber zweifelsfrei als die ‚minervische Eule‘, ein uraltes Weisheits-Symbol, zu erkennen, wie sie auf antiken, griechischen Münzen zu finden ist. Ich liebe Eulen. Selbst hier wo ich mir nicht erklären konnte, wie sich der geheimnisvolle Rufer der Nacht auf das Blatt verirrt haben mochte, galt ihm meine ganze Sympathie. Ich kann nicht sagen warum, aber so, wie sich diese Eule vor mir produzierte, fesselte sie meinen Blick in ganz besonderer Weise. Sie erwiderte meine Indiskretion mit einem herausfordernden, ja fast unverschämten Blick aus ihren übergroßen Telleraugen. So starrten wir uns gegenseitig an, bis der Lärm, den Martin üblicherweise veranstaltete, wenn er mit seinem Theologenwanst die steile Treppe herauf schnaufte, den Bann brach. Die Börse konnte ich gerade noch im Bett verschwinden lassen, aber mit dem Kupferstich wusste ich so schnell nicht wohin damit und legte ihn, so gefaltet, dass die minervische Eule unsichtbar war, auf meine Bettdecke, eben noch rechtzeitig, bevor Martin, wieder einmal mit Holzscheiten beladen, zur Türe herein polterte. Ich hatte einfach keine Lust ihm lang und breit zu erklären, wie ich zu diesen Dingen gekommen war. Martin warf demonstrativ laut seine Scheite neben dem Ofen auf den Boden und sah mich vorwurfsvoll an. „Immer muss ich das Holz herauftragen, vom Beschaffen will ich gar nicht reden“, beschwerte er sich. „Ich weiß schon, bin dir auch dankbar dafür. Zum Ausgleich habe ich heute auch etwas herauf geschleppt und Martin, es wird dir gefallen, sogar sehr“, erwiderte ich grinsend und packte nacheinander Brot, Wurst, Käse und Wein aus, genau so, wie ich es mir vorgenommen hatte. Martin sah mir mit ungläubigem Staunen dabei zu. „Wo hast du das alles her?“, fragte er überwältigt, beugte sich über die Speisen und sog genießerisch deren Duft mit geweiteten Nasenflügeln ein. „Gekauft natürlich, was denkst denn du?“ „Bei den Preisen? Woher hast du denn das Geld?“ „Das erzähle ich dir später, jetzt setz dich her und lass uns essen.“ Das ließ sich Martin nicht zweimal sagen, zog sein Messer aus dem Gürtel und teilte, wie weiland sein Namenspatron den Mantel, Brot, Wurst und Käse in zwei einigermaßen gleiche Teile, schob uns jedem eine Hälfte zu, schenkte die Becher randvoll mit Wein, sprach ein kurzes Tischgebet und machte sich heißhungrig über die Gaben Gottes her. Seine unbändige Essenslust hatte manches Mal dazu geführt, dass er schon den Löwenanteil unserer ohnehin nicht üppigen gemeinsamen Speisen in sich hineingestopft hatte, bevor ich überhaupt richtig angefangen hatte zu essen. Das war mir derart gegen den Strich gegangen, dass ich darauf bestand, das Essen vor Beginn der Mahlzeit gerecht zu teilen. Martin gab sich gekränkt, stimmte schließlich widerwillig aber doch zu. Geteilt wurde abwechselnd, gleichgültig, wer für das Essen gesorgt hatte. Meistens beschwerte sich Martin über Ungerechtigkeiten, wenn ich geteilt hatte, vor allem dann, wenn er bereits vor leergegessenem Brett saß und ich noch etwas zu kauen hatte. Am liebsten hätte er die ganze Übereinkunft rückgängig gemacht, was ich natürlich ablehnte. Darauf schlug Martin vor, um unchristlichen Streit zu vermeiden, wie er sagte, dass er die Aufgabe des gerechten Teilens zukünftig ganz übernehme. Ich willigte ein, aus dem gleichen Grund.
Als Martin seinen gröbsten Hunger gestillt hatte, wiederholte er seine Frage über die Herkunft des Geldes, mit dem ich die Kosten für das Festmahl bestritten hatte. Ich konnte mir schon vorstellen, warum er so penetrant auf meinen Finanzen herumritt. Er sorgte sich um die Miete, genauer gesagt, um meinen Anteil der Summe, die für unsere windige Dachkammer fällig war. Während wir es uns schmecken ließen, hatte ich mir etwas zurecht gelegt, von dem ich annahm, dass es seine Sorge zerstreuen würde. Keinesfalls aber würde ich ihm die volle Wahrheit anvertrauen. Ich hatte es mir zur Regel gemacht, wenn ich schon nicht ganz bei den Tatsachen bleiben wollte, wenigsten nichts Neues zu erfinden. Lieber hangelte ich mich möglichst nahe an der Wahrheit entlang, um eventuelle Nachfragen leichter beantworten zu können. Also erzählte ich ihm von dem Vorfall beim „Schwanen“ und dass der Fremde, dem ich geholfen hatte, mich anschließend in den Gasthof eingeladen habe. „Wir unterhielten uns beim Wein, aber nach einiger Zeit hatte es der Fremde plötzlich sehr eilig aufzubrechen. So schnell wollte er fort, dass er nicht einmal auf das Zahlen warten wollte. Das Geld das er mir zur Begleichung der Zeche dagelassen hat, war so reichlich bemessen, dass es auch noch für das Essen reichte, das wir eben vertilgt haben.“ Punktum. Alles andere ging ihn nichts an. Martin senkte seinen fleischigen Kopf dorthin wo sein fetter Hals ohne erkennbaren Übergang in die Brust überging. Ich glaubte schon, das sei der Beginn eines Verdauungsschläfchens, da schaute mir Martin voll ins Gesicht und fragte, „worüber habt ihr euch denn unterhalten, du und der Fremde?“ „Über was wohl? Über das, worüber überall geredet wird, über die Revolution und was sie für uns bedeuten könnte“, warf ich ihm hin. „Und was könnte sie für uns bedeuten, nach Meinung des Fremden“, lauerte Martin. „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit für uns und die ganze Welt“, gab ich ihm zur Antwort. Er sah mich bedauernd an, „du bist also auch auf diese ‚Schwamschlawos‘ hereingefallen.“ Abkürzungen waren sein Steckenpferd, diese war mir aber neu. „Schwamschlawos? Was soll denn das wieder heißen?“, fragte ich irritiert. „Schwammige Schlagworte“, verriet er stolz. „Oder wie gefällt dir ‚Schwamasanda‘ für ‚schwammige Massenpropaganda‘? Was meinst du, welche meiner beiden Schöpfungen ist zutreffender?“, stichelte er. „Beide sind falsch, antwortete ich brüsk. „Die Ziele der Revolution sind keineswegs schwammig, sonder rein und klar.“ „Aber warum denn so heftig“, höhnte Martin mit zuckersüßer Stimme, „nimm doch nur einmal die so heiß begehrte Freiheit, die Feindin aller Ordnung, die Hure, derer sich vom Hitzkopf bis zum Säufer jeder Unzufriedene bedient.“ „Sie ist aber auch die Freundin der Erneuerung“, widersprach ich ihm wieder ruhig. „Der Wandel ist ein Phänomen der Zeit und nicht der Freiheit. Die ist lediglich eine Fiktion, unter der jeder etwas anderes versteht.“ Damit war es vorbei mit meiner Zurückhaltung. „Die Forderung nach Freiheit von Bevormundung und Hunger ist weder schwammig noch fiktiv, sonders etwas sehr Reales. Gerade du solltest, wenigstens was den Hunger anbelangt, Verständnis haben.“ Tatsächlich räumte er ein, „was den Hunger betrifft, stimme ich dir zu, mit der Bevormundung ist es etwas anderes. Du studierst doch Geschichte, da solltest du wissen, dass die Masse weder zur Freiheit begabt ist, noch sie wirklich will. Sie führt die Freiheit zwar gerne im Mund, weil sie sich allerlei von ihr erwartet, oft nichts Gutes, nur eines will sie nicht, Verantwortung, die unbequeme Schwester der Freiheit, zu tragen. Die Masse lechzt nach Autorität, zu der sie empor blicken und auf die sie alle Verantwortung abwälzen kann. Ihr folgen sie klag- und fraglos, vorausgesetzt es wird für sie gesorgt.
Читать дальше