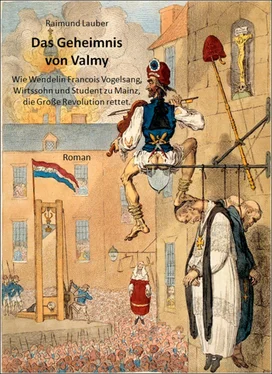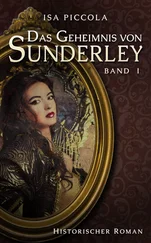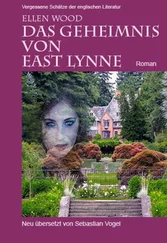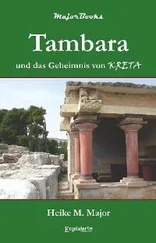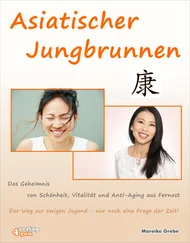Kurz bevor wir wieder in Mainz ankamen, rückte ich damit heraus, was mich den ganzen Rückweg beschäftigt hatte. Was denn nun unsere erste gemeinsame Befreiungstat wäre, fragte ich Poggibonsi. Er nahm freundschaftlich meinen Arm und sagte belustigt, „du kannst es wohl kaum erwarten dir deine Sporen zu verdienen, Francois. Ich fürchte, dass du dich noch etwas gedulden musst.“ Ich maulte, dass es mir überhaupt nicht gefalle untätig herumzusitzen und darauf zu warten, dass er vielleicht irgendwann eine Aufgabe für mich fände. Darauf ließ er sich wenigstens dazu herbei, mir in groben Umrissen darzulegen, was zu tun sei, um in der aktuellen politischen Lage „unserer Sache“ zu dienen. Wenn ich seine geschichtlichen und philosophischen Abschweifungen über die Verdienste der Griechen und Römer für die Entwicklung eines gerechten Staatswesen vernachlässige, mit denen er seine Ausführungen garnierte, lief seine Aussage im Kern darauf hinaus, dass der Kampf um Menschenwürde und Menschenrechte bis vor Kurzem nur auf geistiger und künstlerischer Ebene ausgefochten werden konnte. Er wählte drei Beispiele aus 7, die er mir in aller Sorgfalt erläuterte: Rousseau, mit seinen Vorschlägen für eine bessere Gesellschaft, Beaumarchais, mit seinem, selbstzerstörerisch auch vom Adel gefeierten, durch und durch subversiven Stück „Figaros Hochzeit“ und den Maler David, der in seinem gleichfalls hochgelobten Werk „Der Schwur der Horatier“, triefend pathetisch, aber wirksam, republikanische Werte preist. Alle Drei der Vernunft verpflichtet und alle drei Freimaurer. Es war phantastisch zu hören, wie sie, jeder auf seine Weise, ohne jede förmliche Absprache, nur inspiriert durch übereinstimmende Gesinnung, dem gleichen Ziel dienten: Dem Sturz der Monarchie. Ich glaubte, Poggibonsi habe mir die Augen dafür geöffnet, auf welche Weise die Freimaurer ihre Ziele verfolgen. Ich war hingerissen, aber bevor ich ihn mit Fragen bestürmen konnte, nahm Poggibonsi seinen Faden wieder auf. Die Zeit des Theoretisierens sei vorbei. Im revolutionären Frankreich habe man einen starken Arm gefunden, der es sich zur Aufgabe gemacht habe, beides, Menschenwürde und Menschenrechte, in die Welt zu tragen. Daraus ergebe sich, dass wir die Revolution unterstützen und am Leben erhalten müssen. „Kannst du dir vorstellen, daran mitzuwirken, eine bessere Welt zu schaffen, als die, die wir vorgefunden haben?“, fragte er leidenschaftlich. Der Flug seiner Gedanken schien mir gefährlich hoch, doch ich konnte mich seinem Feuer nicht entziehen. Ein Markstein auf dem schwierigen Weg zu einer besseren Welt, erklärte er mir, sei die Revolution in Frankreich. Jetzt gehe es vor allem darum, ihr die Zeit zu verschaffen, sich zu etablieren, damit, wenn sie fest im Sattel säße, sie ihre Ideale brüderlich über den ganzen Erdball verbreiten könne. Deshalb sei es unsere heilige Pflicht, alle Versuche, das alte Regime wieder herzustellen, zu unterlaufen. Mit ihren Widersachern im eigenen Land würde die Revolution selbst fertig. Die Gefahr käme von außen, von den europäischen Fürstenhöfen, die, wohl zurecht, um den Bestand ihrer Herrschaft fürchteten, sollte die Revolution Schule machen. Die Brüder Ludwigs XVI., Graf d´Artois und der Graf der Provence träten zusammen mit dem Prince de Conde´ als deren natürliche Verbündete auf. Sie versprachen, das Revolutionsübel mit der Wurzel auszureißen und die Monarchie in Frankreich schnellst möglich wieder herzustellen, in alter Form versteht sich. Poggibonsi stieß ein bitteres Hohngelächter aus. „Und sie sind erfolgreich“, fuhr er fort, „nicht zuletzt, weil sie vorgaukeln, ein Marsch nach Paris sei lediglich ein Spaziergang, ohne jedes Risiko. Die Revolutionstruppen setzten sich aus Haufen ungedienten Gesindels zusammen, von denen kein nennenswerter Widerstand zu erwarten wäre und die Bevölkerung würden die alliierten Truppen mit offenen Armen als Befreier begrüßen. Österreich, Preußen, Hessen und Schweden rüsteten bereits zum Krieg. Der Oberbefehl über die alliierten Truppen sei auch schon vergeben. König Gustav III. von Schweden sei damit betraut worden. Das dreisteste aber sei, dass die Emigranten im Rheinland, also auf Reichsgebiet, eigene Truppen sammeln. „Kaiser Leopold, Gott hab‘ ihn selig, hätte das niemals geduldet. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass er kurz vor seinem Tod den Entschluss gefasst hatte, die Emigranten unter Beobachtung zu stellen. Sein Sohn und Nachfolger Franz aber unterstützt ihre Pläne. Verstehst du jetzt, wer unsere Gegner sind?“, fragte er eindringlich. Ich verstand ihn sehr gut. Gerade hatte er alle Fürsten Europas zu unseren Feinden erklärt. Ich fürchtete ernstlich um seinen Verstand und wäre ich selbst bei Sinnen gewesen, so hätte ich jetzt zu ihm adieu sagen müssen. Aber derlei kam mir überhaupt nicht in den Sinn. Stattdessen erkundigte ich mich vorsichtig, was er denn gegen eine derart erdrückende Übermacht auszurichten hoffe, zumal ja das Unheil bereits rolle und wohl kaum mehr aufzuhalten sei. Mit der vollkommenen Gelassenheit, wie es einem Herrn seiner Art entspricht, beschied er mir, dass er nicht gedenke den Kriegstreibern das Feld kampflos zu überlassen. Als ich ihm vor Augen führte, dass die Gegenseite wohl kaum tatenlos zusehen würde, wenn er sich anschicke, ihre Kreise zu stören, winkte er verächtlich ab. Dazu müsste man zuerst einmal bestimmte Ereignisse richtig zu deuten wissen und dann auch noch in der Lage sein, sie mit ihm in Verbindung zu bringen, was er zu verhindern wisse. Später, wenn er sein Ziel erreicht haben würde und alle Welt darüber staune, welch unerwartete Wendung das Schicksal einem wichtigen Ereignis bereitet habe, würde das Fehlen von brauchbarem Wissen um die wahren Hintergründe, durch Phantasie ersetzt werden. Spekulationen, Gerüchte, Verdächtigungen, Verleumdungen und Geheimniskrämereien aller Art würden zu einem buntschillernden Brei zusammengerührt und mit mancherlei berühmten Namen garniert. Einer aber würde fehlen, nämlich seiner. In seinem Metier dürfe man nicht eitel sein. Er lachte verhalten. Meine Sorgen um ihn wuchsen und ich bestand darauf zu erfahren, was er nun konkret vorhabe zu tun. Nach einigem Hin und Her rückte er damit heraus, dass ihn sein erster Weg nach Wien führen werde. „Ihr wollt „Caesar“, Euren Vertrauensmann am Wiener Hof kontaktieren, nicht wahr?“, rief ich aufgeregt und bekniete ihn mich mitzunehmen, weil er bei dem, was er sich vorgenommen habe, mit der sanften moderatia allein wohl kaum auskomme. Aber er lehnte ab. Die moderatia verlange ihren Freunden mehr Tapferkeit ab, als ich ahne und es wäre viel wichtiger für mich fleißig zu studieren, als mit ihm in der Welt herumzureisen. Dazu wäre später noch Zeit genug. Er knöpfte umständlich seine quittengelbe Weste ein stückweit auf, fuhr mit der Hand hinein, nestelte innen an irgendetwas herum und brachte schließlich eine Börse zum Vorschein. „Hier Francois, nimm!“, sagte er und reichte sie mir. Verwundert fragte ich ihn, ob ich die Börse für ihn verwahren solle. „Nicht doch“, antwortete er, „sie ist für dich, zu deiner Verfügung.“ „Für mich?“ staunte ich und setzte an zu fragen, „aber wie komme ich, wie kommt Ihr dazu…?“, kam aber nicht weit damit. Poggibonsi liebte es nicht, wenn sein Redefluss unterbrochen wurde. Wahrscheinlich hatte er auch keine Lust, seine großherzige Geste zerreden zu lassen und überging meinen Einwurf. „Der Inhalt ist nicht üppig, aber bei sparsamer Verwendung sollte er während meiner Abwesenheit genügen, ohne lästige Geldsorgen studieren zu können.“ Ich floss über vor Rührung und setzte schon zu einer zweiten Umarmung an diesem Tag an, ließ aber davon ab, als ich sah, wie er in Erwartung meines Ansturms seinen Stock fest auf den Boden setzte, um sein Gleichgewicht zu sichern. Ich beschränkte mich also darauf, dankbar seine ledrige Hand zu drücken und zu versprechen, mit dem Geld gewissenhaft umzugehen. Den Rest wollte ich ihm wieder aushändigen. Poggibonsi machte seine Hand frei und wehrte die Rückgabe des Restgeldes höflich ab. Das sei nicht nötig, meinte er, aber eines wäre noch zu sagen bevor wir uns trennten. „In der Holzstraße gibt es einen Kaufmann namens Patocki. Er genießt mein Vertrauen. Statte ihm doch von Zeit zu Zeit einen Besuch ab und frage nach mir. In wirklich dringenden Fällen bin ich durch ihn erreichbar. Er weiß von dir. Wenn du Hilfe brauchst wird er dir beistehen. Du kannst ihm vertrauen, er ist Jakobiner.“ Beklommen fragte ich, „gibt es denn gar nichts, das ich tun kann?“ „Ich wüsste nicht was das sein sollte, du etwa?“ Ich wusste nicht was antworten und schwieg verlegen. Da legte mir der sonst so spröde Mann eine Hand auf die Schulter, nahm die meine mit der anderen und sagte mit weicher Stimme, „nun denn adieu, Francois, und sei fleißig.“ Dann stakste er davon. Ausgedehnte Abschiede waren seine Sache nicht.
Читать дальше