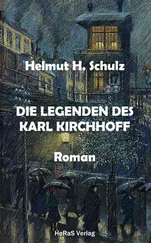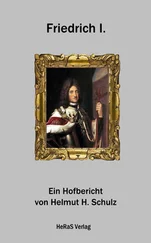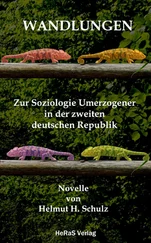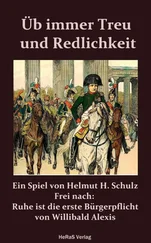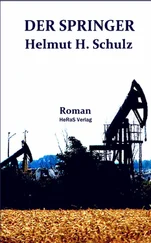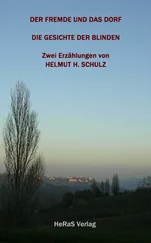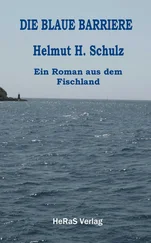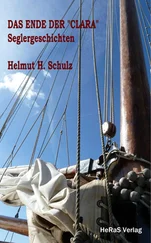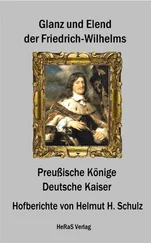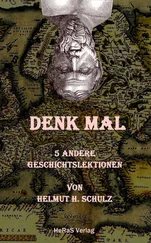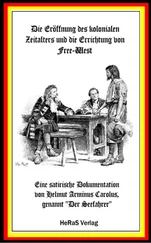Die »2. Internationale« von 1889 faßte denn auch bedeutsame und weitreichende Beschlüsse, etwa den zur Solidarität der Arbeiterparteien im Kriegsfalle, der in naher Zukunft erwartet wurde. Bis zum Kriegsausbruch 1914 wiegten sich die Sozialdemokratien, die mittlerweile offen regierungs- und koalitionsfähig auftraten, in der Zuversicht, ein Krieg könne auf Grund der Beschlüsse gar nicht mehr stattfinden. Tatsächlich aber hatten sich die sozialistischen Parteien innerhalb von runden zwanzig Jahren anders orientiert. Auch diese Internationale scheiterte an den Realitäten; alle ihre Mitglieder reagierten 1914 bescheiden großsprecherisch und »national«, und schickten ihre Mitglieder in den 1. Weltkrieg. Das bedeutete das Ende der Organisation, aber auch das Ende aller Hoffnungen auf ein Hineinwachsen in die schöne neue Welt, falls man sich nur Zeit ließ. Die Ernüchterung der einfachen Mitglieder unterhalb der Funktionärsschicht war furchtbar; erst die Revolution in Rußland begann neue geistige und materielle Kräfte in Gang zu setzen.
Ganz untätig aber war die Internationale doch nicht gewesen. In Zimmerwald bei Bern trafen sich zwischenzeitlich die letzten der Mohikaner, die Absprengsel der »2. Internationale« 1916, um die Lage zu beraten. Sie erneuerten den alten Antikriegsbeschluß und stellten die Weichen für einen Neuanfang bei dem zu erwartenden wie erhofften Kriegsende, im Grunde einer allgemeinen Niederlage der kriegführenden europäischen Mächte. Im März 1919, unmittelbar nach der Oktoberrevolution, wurde schließlich die »3. Internationale« gegründet; sie erhielt als »Komintern« ein besonderes Flair als ein berüchtigtes bolschewistisches Machtinstrument. Der Assoziation wurden auch alle möglichen Aufgaben zugedacht; vom Nachrichtensammler bis zum Terroristen. Die alte Sozialdemokratie bestand in offener Gegnerschaft zu ihren Absprengseln fort und mußte theoretisch reagieren. In dieser Periode wurden unter anderem eine ganze Reihe von Vereinigungen ähnlicher Art und Struktur gebildet; darunter eine mit dem kuriosen Namen: »2 ½ Internationale«, die der roten nicht ganz nahe stand oder stehen wollte, und von der heute kein Mensch mehr etwas näheres weiß und etliche Gewerkschaftsinternationale, darunter die »Rote Gewerkschaftsinternationale«, RGI, die der »3. Internationale« naturgemäß als einer ihrer Untergliederungen am nächsten verwandt gewesen ist.
Generalsekretär dieser RGI war damals der Genosse Solomon Losowski, ein alter Mitkämpfer Lenins. Beide Männer, Losowski und Merker, fanden im Laufe ihrer gemeinsamen Arbeit offensichtlich persönliche Sympathie füreinander. Losowski nahm des weiteren eine bemerkenswerte Karriere im stalinistischen Staat; er wurde stellvertretender Außenminister, und zwar ausgerechnet im Jahre 1939, dem Jahr des deutsch-sowjetischen Paktes. Weshalb Merker plötzlich 1930 aller seiner Funktionen enthoben wurde, wird mit einer der immer wiederkehrenden dürren Begründung umschrieben: Es soll sich sein Standpunkt von der Parteilinie unterschieden haben. Sein Sturz hing mit einer Schwankung in der sowjetischen Kaderpolitik zusammen, so vermutete Herbert Wehner in einer Marginalie seiner autobiographischen Darstellung. Maßregelungen trafen auch oder sogar hauptsächlich Losowski; er wurde nicht gänzlich fallen gelassen, aber sein Einfluß sank so weit, daß auch seine Freunde und Mitarbeiter etwas von der Disziplinierung zu spüren bekamen. Es ist übrigens merkwürdig, daß, wer achtzig Jahre später auf Suche nach genauerer Unterrichtung in den Parteianalen gerade dieses Jahrzehntes blättert, ohne einer kommunistischen Partei nahe gestanden zu haben, nicht viel mehr erfährt, als die jeweils aktuellen Nuancen ein- und derselben Procedere; Querelen, Machtgerangel, Sektenbildung, ein ausufernder Jesuitismus, ganz wie Rosa Luxemburg es warnend vorhergesagt hatte. Deshalb wurde zwar ihres Totschlages in der DDR gern gedacht, nicht aber ihre theoretischen Arbeiten in voller Übersicht zur Unterrichtung der jungen Generation bereitgestellt.
In Lenins Organisationsschema sah Rosa Luxemburg die größte Gefahr für die russische Sozialdemokratie, weil es die »noch junge russische Arbeiterbewegung« den »Herrschaftsgelüsten der Akademiker« aufopfere, sie in den Panzer eines bürokratischen Zentralismus« einzwänge, die kämpfende Arbeiterschaft zum gefügigen Werkzeug eines »Komitees« herabwürdige. Und gerade weil Rußland am Vorabend einer bürgerlichen Revolution stand, kam es darauf an, die freie Initiative und den politischen Sinn der Arbeiterelite zu entfesseln, anstatt sie, von einem Zentralkomitee, »politisch geleithammelt und gedrillt« den bürgerlichen Demagogen zu überlassen. Zitiert nach: Maximilian Rubel. Josef W. Stalin. Rowohlt Taschenbuch Hamburg 1991, Seite 18
Schon 1903 hatte sich die sozialistische Partei, die verbotene russische Sozialdemokratie, in Bolschewiki und Menschewiki gespalten, und zwar auf dem Londoner Parteikongreß, also in der Emigration. Zur Spaltung kam es über die Grundsatzfrage, Revolution oder Reformen und den Leninschen neuen Normen des Parteilebens, eine Problematik, die zum Auszug der Sozialdemokraten aus dem Kongreß geführt hatte und den »Mehrheitssozialisten«, den Bolschewiki, das Feld überließ. Anzumerken ist, daß der Begriff Mehrheit irreführend die tatsächlichen Relationen zwischen den Fraktionen des Kongresses nicht spiegelte. Der Vorgang selber, der Auszug der Menschewiki, hatte allerdings weitreichende Folgen; die bolschewistische Parteidisziplin führte zur Oktoberrevolution und legte den Grundstein zu einer Kader- und Überwachungsstruktur, an der Partei und Revolution am Ende dieses revolutionären Jahrhunderts zugrunde gehen sollten. Es war der Halys der Kommunistischen Bewegung. Den Fluß Halys hatte Kroisos, das Orakel mißverstehend, in der Annahme überschritten, er werde die Perser besiegen, aber er hatte sein eigenes Reich zerstört. Dies ist zwar lange her, aber gleichwohl lehrreich.
Merker selber wehrte sich nur schwach gegen seine Rückstufung in den politischen Volontärsstand; daß er plötzlich ganz mittellos und ohne Einkünfte dastand, zählte während der Wirtschaftskrise doppelt schwer. Er lebte in dem hektischen, aufgeregten Berlin. Sollte er den Leuten als Aushilfskellner wieder Molle und Korn an den Tisch tragen, er, ein oberster Gewerkschaftssekretär, vielleicht mit seiner Visitenkarte präsentierend, ehemaliger Kominternsekretär sucht Stellung? Seit mehr als zehn Jahren hatte seine Arbeit aus Sitzungen, Auftritten in Versammlungen, dem Erstellen von Theoriekonzepten, Plänen, Beratungen, Reisen und einigen politischen Publikationen bestanden; er war geprägt, es gab kein Zurück in einen bürgerlichen Beruf ohne politischen Gesichtsverlust. In dieser Lage half der Freund Losowski aus, der doch selber oben nicht mehr gut angeschrieben stand. Er rief, Merker reiste abermals nach Moskau, und übernahm die amerikanische Sektion der RGI. Da er in einem englischsprachigen Land arbeiten sollte, büffelte er englisch und betrat 1931 den geheiligten Boden der rechtsstaatlichen angelsächsischen Demokratie, als Chef der »Roten Gewerkschaftsinternationale«, nun in den Vereinigten Staaten von Amerika. Werfen wir einen Blick hinter die Freiheitsstatue auf die amerikanische Linksliberale und einen zweiten auf die der Kommunistischen Parteien der USA und der Sowjetunion.
Es gab sie, die amerikanischen Kommunisten, die Partei war zahlenmäßig klein, aber ihr zustimmendes Umfeld wuchs während der Depression rasch an. Daß Karl Marx einmal den Europäern die Exekutive der »1. Internationale« entzogen und nach New York verlegt hatte, zählte längst zu den historisch erledigten Angelegenheiten. Unmittelbar nach dem für den moderneren, technisierteren Norden siegreichen Bürgerkrieg war es in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts an der Zeit gewesen, dem neuen Amerika einen proletarischen Begleiter beizugesellen. Dieses Amerika »Abe« Lincolns, all der gerühmten Befreiungs- und Freiheitserklärungen, das Amerika des grandiosen amerikanischen Bürgerkrieges mit seinen wunderbaren Zielen, seinem Sieg und seinen furchtbaren Opfern hatte den Pfad der Tugend allerdings längst verlassen und gerade einen schauerlichen Justizmord begangen: Am 23. August 1927 waren Sacco und Vanzetti nach siebenjähriger Untersuchungshaft auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden.
Читать дальше