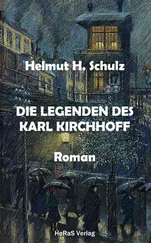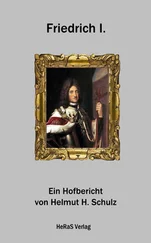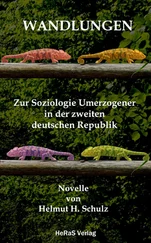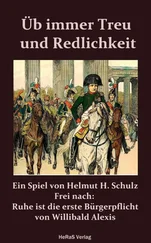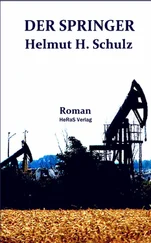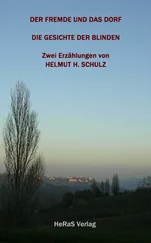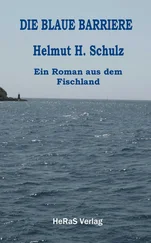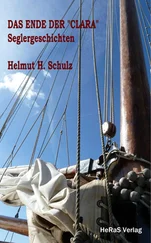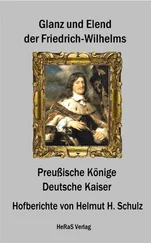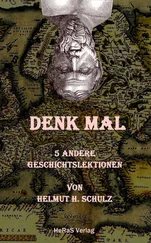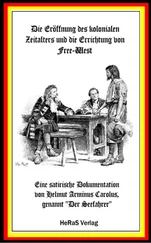Max Hoelz, mit dessen frühem Lebenslauf Merkers Biographie einige Ähnlichkeit aufweist, arbeitete auch einmal als Haussklave sächsischer Thronen und Herrschaften. Immerhin war es für diese Zeit nicht ungewöhnlich, daß gerade junge Linke aus den unteren Klassen Bildung - in jedem Sinne - für ebenso wichtig hielten wie Brot. Sie sollten und wollten das Erbe der bürgerlichen Kultur antreten, pflegten mit mehr Verehrung Umgang mit den deutschen Klassikern als manch ein Bürger. Der sich durchhungernde Proletarier gehört zum klassischen Bild des Aufsteigers. Daran haben Lasalle und die marxistischen Lehrer an den Abendschulen ihren Anteil gehabt. Es gab sie überall im kapitalistischen Europa, diese Wissenschaftsproletarier, die Goethe und Haeckel lasen, die aus »Faust« zitieren konnten und mitreden wollten. Sie förderten viel zutage, aber sie behinderten auch manch eine Entwicklung etwa in der Literatur, als sie gereift waren und handhabbare Regeln für die Kulturgestaltung aufstellten; an ihrem Dogmatismus sollten noch Generationen zu kauen haben. Wer heute Gelegenheit hat, in eine erhaltene Sammlung privater Proletarierbibliotheken zu schauen, der ist verblüfft, wieviel Geld diese Mittel- und Arbeitslosen für Bücher ausgaben. Sie erwarben die billigsten, gewiß, aber sie verschafften sich, wessen sie bedurften. Viele begannen auch selber zu schreiben, diese »Menschenfreunde in zerlumpten Hosen«, wie der programmatische Titel einer der ersten Proletenbiographien überhaupt lautete. Dem Heutigen werden Zweifel kommen, ob die fortschreitende Verblödung und Verödung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen und die Glücksprojektion auf sozialen Wohlstand und Mobilität wirklich im Anbeginn der angestrebten Zeiten lag. Aber zurück zu Merker.
Kellner und Hotelarbeiter kommen weit herum. Merker arbeitete in Dresden und am anderen Ende Deutschlands in Amrum und in Hamburg, erwarb sich also Lebenskenntnis, neben Büchersinn und Bildungslust eine nicht zu vernachlässigende Größe der Selbsterziehung. Was er an der Front im Ersten Weltkrieg getan und unterlassen hat, ist dies: In Mannheim waren in jener Zeit die Luftschiffer stationiert, unter anderem; dort wurde die neue Kampftruppe der Lüfte ausgebildet. Fesselballons bevölkerten alsbald die Himmel über allen Fronten und dienten als Beobachter. Solange bis ihre leichte Verwundbarkeit erkannt wurde. Wegen ihrer Unbeweglichkeit konnte man sich leicht auf sie einschießen; denn allzu hoch durften sie nicht schweben, um als Guckposten nützlich zu sein. Wurden sie nicht rasch genug auf den Boden heruntergeholt, gingen sie in Flammen auf. Zudem hatte sich aus einer technischen Spielerei eine gefährliche neue Waffe anderer Art entwickelt. Flugzeuge, zu Kampfgeschwadern formiert, umkurvten die Gräben der Front, warfen Bomben und führten mit Bordwaffen Kavalierszweikämpfe in der Luft. Den Fliegern boten Fesselballons Ziele wie auf dem Scheibenstand.
In Frankreich und an der Balkanfront diente Merker bei der Bodentruppe. Noch während des Krieges war er Mitglied der unabhängigen Sozialdemokraten geworden, stand also auf halbem Wege zwischen der längst reformerischen Sozialdemokratie, die dem bewaffneten Kampf um die Macht abgeschworen hatte, um in den klassenlosen Staat hineinzuwachsen und den radikalen Kommunisten, die zwar noch keine eigene Organisation besaßen, wohl aber eine revolutionärere Theorie. Als die Novemberrevolution kam, läßt sich Merker noch nicht auf einer entschieden kommunistischen Front ausmachen, wie sein Gegner in Dresden und späterer Freund im mexikanischen Exil, Otto Rühle, nicht zu verwechseln mit einem anderen Otto Rühle, dem Direktor für Hochschulbildung der DDR und Mitbegründer der »Nationaldemokratischen Partei Deutschlands«. Aber die Novemberrevolution sah Merker eben in Dresden, und er hatte insofern daran Anteil, als er gegen jenen KP-Funktionär Otto Rühle auftrat. Aber dies waren für Merker die normalen Orientierungsschritte in einer verwirrenden Revolutionsperiode, wo man öfter den Standort, nicht aber die Fronten wechselte. Zuletzt ging die USPD in die Kommunistische Partei überhaupt auf, womit der Klärungsprozeß für viele, nicht nur für Merkers abschloß.
Im Zeitraum zwischen 1918 und 1920 wurde die Weimarer Republik von einer sozialdemokratisch-bürgerlichen Koalition mehr schlecht, als recht regiert; auch sehr gemäßigte Sozialisten mußten in dieser neuen opportunistischen Machtsuppe mehr als ein Haar finden. Die russischen Revolutionäre von 1917 hatten sich wider aller Erwartung und trotz einem internationalem feindlichem Aufgebot an Waffen und Material in ihren Bastschuhen an der Macht zu halten gewusst. (In der Autobiographie vom Max Hoelz ist ausführlicher von jenem Otto Rühle die Rede, der eine kritische Einschätzung der Kämpfe in Mitteldeutschland schrieb (an denen er nicht teilnahm). Er hält die Aktion für verfehlt und für verfrüht, im Ganzen für falsch und dilettantisch durchgeführt. Die Linken unter den »Unabhängigen« verschmolzen im Dezember 1920 mit den Kommunisten, d. h., sie lösten sich praktisch auf. Rühle spielte keine Rolle mehr. Er starb 1943. Siehe: Max Hoelz. Vom Weißen Kreuz zur roten Fahne. Edition aurora. Mitteldeutscher Verlag. Halle Leipzig 1984)
Noch schlug der Zeiger der Weltgeschichte wild in alle Richtungen aus. Wo würde er zum vorläufigen Stillstand kommen? Der Glaube an die neue sozial gerechtere Welt erhielt durch die siegreichen Sowjets dauernd Auftrieb, und das Erlösungsziel, die Welt der Gleichen und Brüderlichen schien greifbar nahe. Davon zeugte die Reihe einzelner bewaffneter aber begrenzter Aktionen, die mit den Januarkämpfen 1919 in Berlin begonnen hatten. Wenn auch alle Aufstände in Mitteldeutschland, in München und an der Ruhr verloren gingen, befand man sich offenkundig auf einem Weg, an dessen Ende das kommunistische Fernziel lag, die klassenlose Gesellschaft, und alle kleineren Niederlagen erschienen den Rebellen eher wie Fanale des sicheren künftigen Sieges, als die Menetekel des endgültigen Verlöschens der deutschen roten Revolution. Ab 1922 lebte Merker in Berlin und war in verschiedene Funktionen aufgerückt, Mitglied des Zentralkomitees und seines Politbüros, zum anderen war er Leiter der Gewerkschaftsabteilung seiner Partei. In dieser Eigenschaft machte Merker eine für ihn wichtige Reise in die Sowjetunion, um als Delegierter bei den Beratungen der »Roten Gewerkschaftsinternationale« teilzunehmen. Er betrat zum ersten Male internationales Pflaster. Hier ist ein Rückblick auf die Geschichte der Internationale nötig.
Seit 1863 und 1864 befaßten sich Kommunisten und Sozialdemokraten, damals parteiamtlich noch nicht grundsätzlich voneinander unterschieden und erbittert verfeindet, in Gemeinschaft von Anarchisten, der weitaus »revolutionärsten« Gruppe, mit der Installierung einer internationalen Arbeiterassoziation. Gründungstermin und Ort der »1. Internationale« waren Genf 1866, nach und nach traten ihr fast alle europäischen bis kommunistischen Einzelparteien bei, getreu der berühmt gewordenen marxistischen Maxime: »Proletarier aller Länder, vereinigt euch!«. Der Verein war zwar vereinigt, aber keineswegs einig, sondern tief zerstritten und von Bakunin dominiert. Bakunin, russischer Anarchist und Exilant mit einem großen europäischen Anhang, verlor nur allmählich an Boden, wurde endlich ausgeschlossen, und Marx selber empfahl zuletzt die Verlegung der Exekutive von London nach New York, sicherlich infolge des amerikanischen Bürgerkrieges, dessen Verlauf die beiden Londoner Emigranten mit wachem Instinkt verfolgten. Für Marx und Engels war der Bürgerkrieg in Amerika ein revolutionärer Krieg, und es war ein moderner Krieg, in dem ein gewaltiger technischer Aufwand getrieben wurde. Mit dem Sieg der Nordstaaten mußte ein übermächtiger industriell-kapitalistischer Block in der westlichen Hemisphäre entstehen, die neuen Vereinigten Staaten von Amerika. Indessen konnte die Internationale trotz des Wechsels von Europa nach Amerika ihren Spielraum nur gering erweitern, im Gegenteil, sie zerfiel, aber das Bedürfnis nach einem übernationalen Zusammenschluß aller Proleten der Welt blieb und schuf die Voraussetzungen für eine Nachfolgeorganisation.
Читать дальше