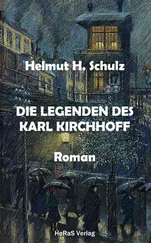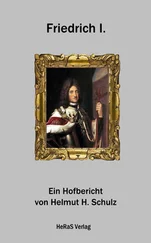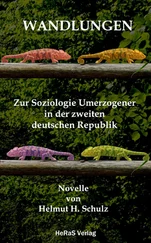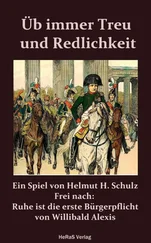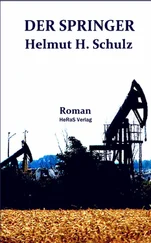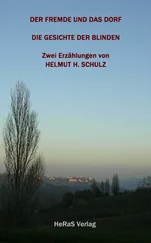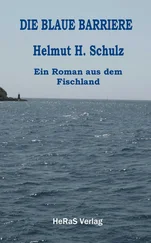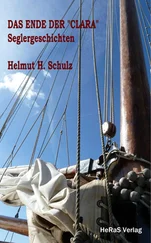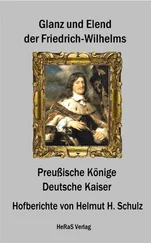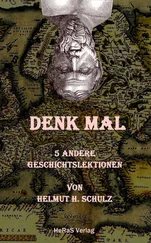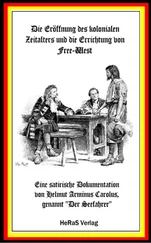Mexiko, wo der Emigrant Merker Fuß gefaßt hatte, war eines der großen Zentren für zahlreiche deutsche Exilanten. Der mittelamerikanische Staat hatte seine europäischen Geschäftsträger beim Erteilen von Einreisevisa ungewöhnlich freie Hand gelassen. Das kleine Land hatte mehr Flüchtlingen Zuflucht geboten, als die großen Staaten der westlichen Hemisphäre. Die ersten Etappen des fluchtartigen Exils in Richtung Westen hießen im Frühjahr 1933 Frankreich, die Niederlande und die Tschechoslowakei. Dort sammelten sich kurz nach dem 30. Januar 1933 flüchtige Politiker und Funktionäre, gründeten Komitees, Verlage, Zeitungen und Zirkel, klärten die Gastländer und die Welt über die Verhältnisse in »Nazideutschland« auf, und schufen die Strukturen für den illegalen Vertrieb ihrer Druckerzeugnisse nach Deutschland. Sie prägten tatsächlich weithin das Bild Hitlerdeutschlands im Ausland und waren also höchst erfolgreich. Infolge des österreichischen Anschlusses, der Auflösung der Tschechoslowakei, während der Besetzung Frankreichs und der Niederlande durch die Wehrmacht wurde der Menschenstrom in Bewegung gehalten oder noch verstärkt, zuerst in das noch unbesetzte Frankreich. Die Hafenstadt Marseille wurde zum Sprungbrett in die »Neue Welt«. Von einer Hafenstadt aus scheint das Entkommen per Schiff immer denkbar leicht. Solange die Abreise mit den normalen Paßprocedere verbunden ist, die kompliziert genug sein können, stimmt das auch. Hier aber lagen die Verhältnisse ganz anders.
Die Vichy-Regierung hatte sich in dem Abkommen mit Deutschland zur Auslieferung gesuchter Deutscher wie zur Einrichtung von Internierungslagern in dem von ihr verwalteten Teil Frankreichs verpflichtet. Zwar oblag den französischen Dienststellen die Aufsicht, aber in der Praxis war die Hoheit auch im unbesetzten Teil Frankreichs wesentlich eingeschränkt durch Gestapo und Wehrmacht. Wem die Flucht aus dem unter deutscher Besetzung stehenden Teil Frankreichs in die freie französische Zone gelungen war, aber zuletzt doch aufgefischt wurde, der kam in eines der Internierungs- und Abschiebelager. Allerdings, und darauf fußte vielfach das Überleben der Flüchtlinge, ließ sich nicht alles aus dem paraphierten Vertrag auf den unteren Verwaltungsebenen auch wirklich durchsetzen. Dort saß neben den gewöhnlichen Diensttuern auch der französische Widerstand. Alle Dienststellen waren überdies durchsetzt von den Mitarbeitern verschiedener Nachrichtendienste. Vorsicht war auf allen Ebenen dringend geboten. Von Marseille aus versuchten sich also Leute, die gefährdet waren und ihre Auslieferung an Deutschland oder eine dauernde Internierung in Frankreich befürchten mußten, möglichst rasch die nötigen Einreisevisa für irgendeines der Aufnahmeländer zu verschaffen, die Aufenthaltsgenehmigung eines freien Staates, sowie die bezahlte Schiffskarte für die Überfahrt zu ergattern. Es war regelmäßig ein langer Weg, bis der Emigrant den Dampfer besteigen konnte, der ihn in der neuen Welt an Land setzte, wo dann freilich die Sorgen anderer Art begannen, die ums einfache Überleben, die Tatenlosigkeit, das Warten auf die mögliche Heimkehr, falls sich wie erhofft die Verhältnisse in Deutschland änderten. In die nahe Schweiz gelangte nur, wer gute, wer sehr gute Beziehungen besaß, weil die ordentlichen Eidgenossen ihre Grenzen gut bewachen, aus verständlicher Notwehr, wollten sie nicht von europäischen Emigranten und Flüchtlingen überflutet und zu einem riesigen Aufnahmelager werden. Es blieb also die Hoffnung auf eine Schiffskarte in einen Teil der neuen Welt.
Diese Szenerie reizte zur künstlerischen Darstellung, sie ist gleich mehrfach literarisiert worden, das heißt, die Welt wußte eigentlich immer ziemlich gut Bescheid, was im nichtbesetzten Frankreich und in Nordafrika, dem französischen Hoheitsgebiet am Rande der Sahara, vor sich ging. Jedermann kennt den Klavierspieler und den selbstlosen Mann des Kultfilmes »Casablanca«, der sich von Ingrid Bergmann in die Augen sehen läßt. Wer sich ohne melodramatisches Drumherum literarischer informieren will, der kann in Seghers »Transit« nachblättern. Dort erfährt er, was ein Transit ist, was ein Visum bedeutet, ein Visa de Sortie , ein Danger-Visa und ein Sauf-Conduit . Ganz ohne Melodramatik, Liebe und verschmähter Liebe geht es auch hier nicht. Aber wie normal-verwickelt die Verhältnisse werden können, wenn sich Tausende von einem Land ins andere aufmachen, wenn der Einzelne nicht die erforderlichen Papiere besitzt, das erfuhr Paul Merker am eigenen Leibe. Er war 1933 keineswegs ein heuriger Hase, der das Einmaleins illegaler Existenz erst noch zu erlernen hatte, ganz im Gegenteil.
Bis zur Besetzung Frankreichs durch die Wehrmacht arbeitete eine Außenstelle der Kommunistischen Partei, ein sogenanntes Zentralbüro der KPD, in Paris. Es wurde von einem Gremium geleitet, dem Merker in der fraglichen Zeit angehörte. In das auswärtige Büro kam man durch die allerhöchste Zentrale der exilierten Partei, die sich in Moskau niedergelassen hatte, von Wilhelm Pieck geführt. Der Funktionär wurde nach Paris delegiert, wieder abgezogen, zur Berichterstattung gerufen, alles, was bis zum Kriegsbeginn 1939 zwar mit Erschwernissen verbunden, was nicht ungefährlich, aber auch noch nicht völlig unmöglich gewesen ist. Es gab eine spezielle Schleuserschiene, einen Weg mit guten Lotsen, der sich »NKWD Schleuse« nannte.
Um etwas Übersicht in den Lebenslauf Paul Merkers zu bringen; er wurde 1894 im sächsischen Oberlößnitz geboren, besuchte die Volksschule, absolvierte eine Kellnerlehre und zog 1914 in den Ersten Weltkrieg, wie alle seines Jahrgangs. 1918 wird er Mitglied der USPD, der »Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei«, wechselt 1920 zur KPD, und wird Sekretär einer Gewerkschaft der Hotel- und Restaurationsangestellten. Die nächste Station auf der politischen Leiter ist die Funktion eines KPD-Sekretärs für den Bezirk Westsachsen. In den Jahren zwischen 1926 und 1930 ist Merker bereits Mitglied des ZK der KPD und des Politbüros, ist also schon bis in die Führungsspitze aufgerückt. Er wird Kursant an der »Internationalen Leninschule« in Moskau und Sekretär der »Roten Gewerkschaftsinternationale«, einige Jahre Aufenthalt in Amerika folgen. Zwischen 1934 und 1935 arbeitet Merker illegal in Deutschland. Schließlich wird er wie erwähnt in das Büro der KPD-Leitung nach Paris geschickt, 1940 in Frankreich interniert, aber er entkommt in letzter Stunde, 1942, nach Mexiko.
Dort findet er eine ganze Reihe berühmter deutscher Linker und Kommunisten vor, und gründet mit einigen die Bewegung »Freies Deutschland«. Nach Deutschland kehrt Merker 1946 zurück, und nimmt als ehemals hoher Funktionär einen Platz im Parteivorstand, später dem Zentralkomitee der SED ein. Wieder ist er Mitglied des Politbüros. Nach Gründung der DDR wird Merker Staatssekretär im Ministerium für Land- und Forstwirtschaft. Um am 24. August 1950 aus der Partei ausgeschlossen zu werden und aller seiner Ämter verlustig zu gehen. Er ist sechsundfünfzig Jahre alt. Seit gut dreißig Jahren hat er nichts anderes gemacht, als politische Arbeit, illegal und legal, er ist ein Berufsrevolutionär gewesen, und er hat nach der Leninschen Norm gelebt. Seine Arbeit bestand darin, anderen zu erklären, was sie zu tun oder zu lassen haben, wenn sie vor der Parteilinie bestehen wollen, Schriften zu verfassen und drucken zu lassen, Versammlungen einzuberufen und zu leiten, zu taktieren und den Glauben an eine Zukunft wachzuhalten oder zu erwecken, von der er am Ende seines Weges nur noch eine vage Vorstellung gehabt haben mag. Nach seinem Fall hat Merker noch neunzehn Jahre bis zum Tode sehr zurückgezogen gelebt, bis zum Vergessen.
In die zweite Hälfte der Zwanziger Jahre, als Merker dem kommunistischen Machtzentrum sehr nahe gekommen war, fielen eine ganze Reihe von Vorentscheidungen, die das künftige innere Gefüge des Sowjetstaates bestimmen sollten. Paul Merker wurde 1930 wie oben gesagt mit immerhin schon 36 Jahren an der »Internationalen Leninschule« in Moskau auf eine Rolle in der Komintern vorbereitet. Wie kam es dazu? Auf eine für damalige Verhältnisse nicht ungewöhnliche Art und Weise. Merker hatte als Volksschüler eines sächsischen Nestes nur eine geringe Allgemeinbildung erwerben können, besaß aber Wissensdrang und genug Neugier, um sich einen eigenen Weg in die Welt voller Widersprüche zu bahnen. Als Hausdiener eines sächsischen Barons, der eine umfangreiche Bibliothek sein eigen nannte, verschaffte sich der junge Merker Einblick in die Bücher, die er auf anderem Wege nicht zu lesen bekommen hätte. So jedenfalls liest man es in den biographischen Notizen zu seinem Lebensweg. Und das hieße, jener Sachsenbaron verfügte über genügend heitere Gelassenheit, um seinem Hausdiener den Gebrauch seiner wertvollen Bibliothek zu gestatten. Vielleicht aber genügte es dem jungen Merker auch, sich mit der Titelliste jener Buchausgaben zu versorgen, die er lesen wollte und von denen er sich eine Bereicherung des Wissens versprach.
Читать дальше