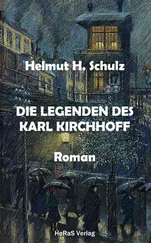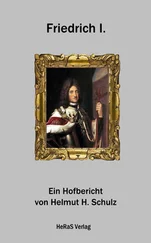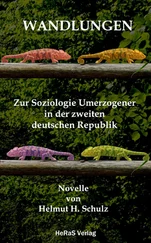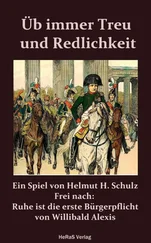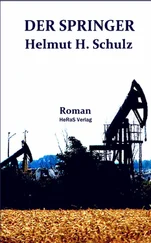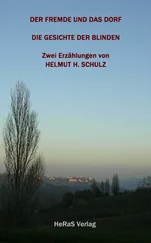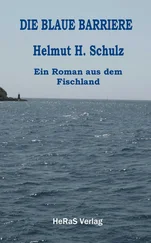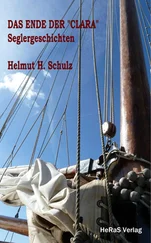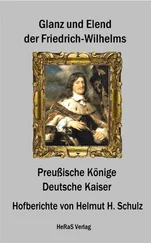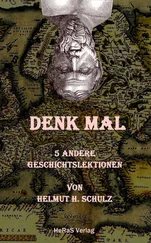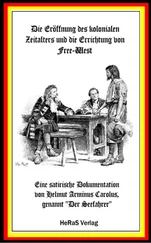Die Kampfhandlungen im Berliner Großraum hatten nicht nur sichtbare Spuren in den Trümmerbergen, die Rote Armee, die »Russen« hatten bei der Bevölkerung auch ein verheerendes Abbild hinterlassen. Zwei unterschiedlich hoch entwickelte Kulturen schienen aufeinandergestoßen zu sein. Das Straßenbild wurde von der »Kommandantura« beherrscht. Das kleine Machtzentrum mit dem riesigen Sowjetstern am kleinbürgerlichen Balkon und dem kurzen, rot oder grün angepinseltem Lattenzaun machten den Berlinern bewußt, daß die Präsenz der Russen nicht so bald enden würde. Zwar richteten sich die ersten Befehle und Maßnahmen der Administration auf die Wiederherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung, der Organisierung von notwendigen Arbeiten, also den wichtigsten Lebensfunktionen, zwar lief die propagandistisch-aufklärerische Arbeit auf vollen Touren, den Zweiflern versichernd, daß nach einer Zeit bedrückenden Überganges Deutschland aufblühen werde, sogar das staatlich eigenständige Dasein, frei und gleichberechtigt in der Völkergemeinschaft, aber der Weg dahin schien beschwerlich und sehr lang. Aufsteller mit stalinschen Maximen und Vorhersagen erzählten den Berlinern etwas von Jalta und Teheranbeschlüssen Abweichendes. In seinem 1947 erschienenen und damals viel gelesenen Werk »Der Irrweg einer Nation«, hat Alexander Abusch die Haltung der »besseren« Deutschen zutreffend beschrieben:
»Die Deutschen müssen wiedergutmachen, was deutsche Hände verbrachen. Ohne diesen ersten und ehernen Grundsatz kann es keine moralische Erneuerung des deutschen Volkes geben. Es handelt sich nicht um Rache, nicht um biblische Schuld und Sühne, sondern - neben der materiellen Hilfe für die ausgeplünderten Völker Europas - um die Hinführung der Deutschen zu ihrem besonderen Selbst, um die Voraussetzung aller Umerziehung. Denn die Vernichtung der Naziverbrecher ist nur ein Teil der deutschen Selbstreinigung.« Alexander Abusch. Der Irrweg einer Nation. Aufbau-Verlag Berlin. 1947, Seite 268
Mit dem Einzug der westlichen Besatzer in Berlin, mit der Einrichtung einer kollektiven Verwaltung der Stadt durch die vier Mächte änderte sich alles von Grund auf, bekam die Entwicklung neue politische gegenläufige Anstöße. Die Antihitlerkoalition begann sichtlich immer schneller zu zerfallen, da sie ihren Dienst geleistet hatte. Die Russen, wie das Volk hartnäckig sagte, die Freunde, wie die Moskauemigranten nicht minder stupide herausstellten, schleppten auf Grund des ihnen zugestandenen Rechtes, sich Reparationen in Sachmitteln zu holen, an Maschinen und Gerät hinaus, was funktionierte; sie kontrollierten Betriebe und entnahmen der Produktion, was ihnen vereinbarungsgemäß zustand. All das zusammengenommen ließ im Volk das Gefühl der Ohnmacht wachsen und den Abzug der Russen herbeiwünschen. Die Amerikaner hingegen brachten schlechthin alles mit, Zigaretten und Bedarfswaren, sie grasten in Jeeps die Schwarzmärkte ab, gründeten Klubs, trotz aller Fraternisierungsverbote vergewaltigten sie die Fräuleins nicht, wie die Russen, sondern bezahlten sie wie Huren. Dieses neue Regime und Element traf auf das damalige Lebensgefühl der demoralisierten Deutschen ohne Zukunftsverheißung. Es war völlig klar, daß sich diese Berliner Verhältnisse in Politik umformen würden und zwar innerhalb kurzer Fristen.
Die Abneigung, der »Antibolschewismus«, genau gesagt, äußerte sich explosiv anläßlich der Wahlen für die Berliner Stadtverordnetenversammlung am 20. Oktober 1946. Seit dem Frühjahr existierte im Ostteil der Stadt die aus der Vereinigung von KPD und SPD entstandene »Sozialistische Einheitspartei Deutschlands«, ein Zusammenschluß, der das einstige Feuer und Wasser miteinander aussöhnen sollte. Die Argumente dafür und dagegen sind zu bekannt, als dass sie hier aufgezählt werden müßten. Für die Einheitspartei gedieh diese halbwegs kontrollierte Wahl zur Katastrophe: Die SED bekam 19,8 Prozent, während die SPD einen beispiellosen Wahlsieg von 48,7 Prozent nach Hause brachte. Dieser Wahlausgang mußte nicht nur als antikommunistisch, er mußte als antisowjetisch, als eine empfindliche Abfuhr der Besatzungsmacht gewertet werden. ( Die Zeitung »Neues Deutschland« brachte unter dem Titel: Differenzierte Sicht, auch beim Rückblick den Leserbrief von Norbert Podewin (ND vom 04. Mai 1999, Seite 15) zu einem vorangegangenen Gedenkartikel. Die SED-Veranstalter rechneten überraschenderweise mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SED und SPD in allen Sektoren, was entweder ihre Unkenntnis der Stimmung unter den Berlinern belegt, oder als Schutzbehauptung gegenüber Moskau zu werten ist. Zitat: »So war es doch wohl ein Schock für die SED am Abend des 20. Oktober als ausgezählt wurde. Bei hoher Wahlbeteiligung (92,3 % / 63 % Frauen) entschied sich nahezu jeder zweite Wähler (48,7 %) für die SPD und nur jeder fünfte (19,8 %) für die SED, die noch immer hinter der CDU (22,1 %) landete. 19 von damals 20 Berliner Stadtbezirken besaßen SPD-Mehrheiten; nur Zehlendorf fiel in CDU-Hand. Es fehlte auch ein gravierendes Gefälle Ost/Westsektoren, zumindest was SPD und SED betraf: Erstere erreichten in den 8 Ostbezirken 43,0 % gegenüber 50,8 % im Westen; angesichts der etwa 30 % der SED im östlichen Teil fiel der französische Sektor mit ca. 28 % kaum ab.« Zitat Ende.)
Paul Merker hat das Fiasko schon miterlebt, da er seit etwa Jahresmitte wieder in Deutschland war. Bei diesem Ergebnis aus Wahlniederlage und Stimmungsbild hat die Goebbels-Propaganda einen späten Erfolg feiern können. Seit den Differenzen in der Antihitlerkoalition, seit dem Eintreffen der westlichen Besatzungstruppen in Berlin und dem Beginn des vierfachen Besatzungsregimes war geflüstert worden, was mehr Wunschglaube als Überzeugung sein konnte, daß die Russen alsbald aus Berlin abzögen, um die Stadt dem Westen zu überlassen, gegen irgendeinen Bagatellpreis von X-Millionen Dollar.
Angesichts dieser Lage sahen die Vertreter der realen Macht in der »Zone«, die Sowjets und die kommunistischen Aktivisten, in die Moskau einiges an Vertrauen investiert hatte, ein, daß etwas am Verhältnis zwischen Russen und Deutschen verbessert werden mußte. Immerhin floß noch viel Wasser die Spree hinunter, ehe sich die Propaganda der Sache annahm. Worauf die Parteiführung gehofft hat, ist ein vollständiges Mirakel, wenn nicht ausschließlich auf die im Ernstfall rettenden sowjetischen Bajonette und in der felsenfesten Überzeugung, Moskau könne die »Zone« aus hunderterlei Gründen nicht fallen und sich selbst, das heißt, dem Westen überlassen. Im »Haus der Kultur der Sowjetunion« in der Straße Unter den Linden, der alten Singakademie, damals ein wichtiges Begegnungszentrum zwischen Russen und Deutschen, wo in der Regel mit größerer Offenheit geredet wurde, kam es erst an zwei Abenden im Dezember 1948 als sich die Situation für Moskau und SED sogar noch verschlechtert hatte, zur Aussprache über den katastrophalen Stand der deutsch-sowjetischen Beziehungen. Prof. Steiniger sagte in einem Diskussionsbeitrag Folgendes:
»Ich höre als das landläufigste Argument in diesem Zusammenhang immer wieder den Satz: Wären die Russen anders zu uns gekommen, in einem anderen gesellschaftlichen Zustand, dann wäre alles ganz anders geworden! Wir wären alle Bolschewisten geworden. Wir waren alle bereit, Kommunisten zu werden, ganz Deutschland war bereit, die Rote Armee als Erlöser zu empfangen. Wir werden über die Verlogenheit dieses Argumentes noch reden müssen.« Peter Alfons Steiniger, Prof., Dr. Dr., jüdischer Herkunft. Ab 1946 Professor für Völkerrecht an der Berliner Universität. Gestorben 1980
Dieser Beitrag enthielt einige Ungereimtheiten, wie leicht hätte einsehen können, wer den Dingen auf den Grund kommen wollte. Erstens hatten die Russen selbst erklärtermaßen nie die Absicht gehabt, aus ihrer Zone eine sowjetische Provinz mit lauter deutschen Bolschewisten zu machen, nicht in völkerrechtlichem Sinne jedenfalls. Dazu hätte es nicht nur einer größeren Abstimmung unter den zerstrittenen alten Koalitionären bedurft, es hätte die Sowjetunion vor eine kaum lösbare Zukunftsaufgabe gestellt, den Ostdeutschen die Zustimmung zur förmlichen Eingliederung immer neu abzugewinnen. Überhaupt war Deutschland nicht die einzige Frage, mit der die UdSSR, eine Weltmacht, zu tun hatte, und von Erlösung konnte ebenfalls keine Rede sein. Die Vorbehalte der Deutschen gegen Russen und Bolschewismus reichten viel tiefer in Geschichte und Kultur hinein, als es der Beitrag Steinigers ahnen läßt. An dem Debakel hatte Merker keinen erkennbaren Anteil; daß die Nachkriegsentwicklung ihn traf, sollte sich indirekt jedoch erweisen.
Читать дальше