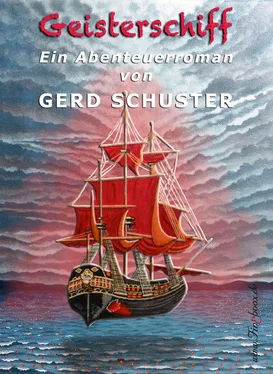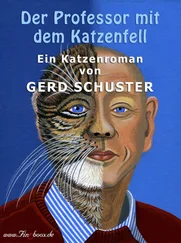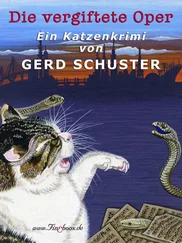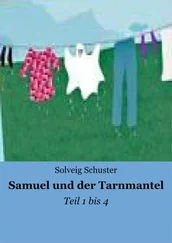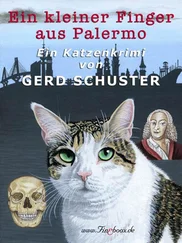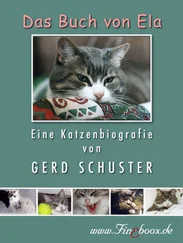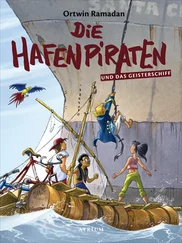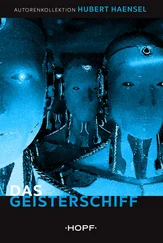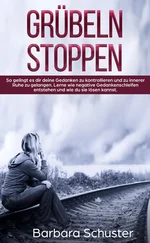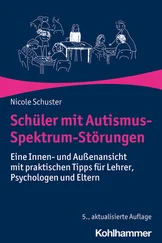Im 16. und 17. Jahrhundert war die Galionsfigur an den Bugspriet gewandert, weil durch das sogenannte Vorderkastell am Bug der Schiffe kein Platz mehr war. Vom 17. bis zur zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war der Löwe als Bugschmuck sehr in Mode gewesen. Später wurde er aber durch zeitbezogene Schnitzereien – die während der französischen Revolution gebaute Fregatte »Carmagnole« trug eine Guillotine vor sich her – oder Figuren ersetzt, die den Namen des Schiffes repräsentieren sollten. So zierten Reeder, Ritter und Kaufleute in Bratenrock und Zylinder die Schnauzen der Koggen, Briggs und Barks.
Während Frauen an Bord nach Überzeugung der Seeleute Unglück brachten, schworen die blauen Jungs Stein und Bein, dass nackte oder zumindest barbusige Damen als Galionsfiguren die Kraft besaßen, Wind und Wellen zu besänftigen. Meerjungfrauen mit Fischschwanz und nackten Brüsten waren sehr beliebt. In den Bildbänden fand ich Dutzende von Nixen, deren Fischschwanz in fast allen Einzelheiten meinem Fund glich.
Obwohl die Crews nach wie vor sehr abergläubisch waren, dienten die Galionsfiguren in späteren Jahren immer mehr dem Renommee. Weil Handelssegler den Reichtum des Eigners, Kriegsschiffe die Macht des jeweiligen Staates repräsentieren sollten, geriet der Bugschmuck oft so prächtig, groß und schwer, dass sein Gewicht die Seetüchtigkeit der Schiffe und ihre Segeleigenschaften beeinträchtigte. Besonders im Barock wogen die Schnitzereien manchmal mehrere Tonnen.
1747 ordnete das britische Marineamt an, dass Galionsfiguren statt aus Eiche aus leichtem Weichholz wie Kiefer zu fertigen seien. Man verwendete aber auch Teak, das widerstandsfähiger gegen Holzschädlinge war.
Weil Dampfschiffe ohne Bugspriet die Segler zunehmend verdrängten, kam das Ende der Galionsfiguren. Ab 1894 fehlten sie auf großen englischen Kriegsschiffen. Kleinere Einheiten behielten sie bis zum Ersten Weltkrieg. Das letzte Schiff der Royal Navy mit einer Galionsfigur war HMS »Espeigle«, die 1923 abgewrackt wurde.
Ich las meine Zusammenfassung noch einmal durch und mailte sie Laxmi. Die Lektüre im Reading Room war zwar spannend gewesen, vor allem wegen der marine– und kulturhistorischen Details und der oft recht zünftigen Anekdoten; aber weitergebracht hatte mich der Tag im British Museum nicht.
Ich rief Laxmi an. Bevor ich meinen Frust loswerden konnte, sagte sie, Professor Edward Hoare aus Oxford habe sich gemeldet. Der Chemiker habe recht aufgeregt geklungen und uns für morgen um 13.00 Uhr in sein College bestellt, das weltberühmte CCC. Er habe das Rätsel gelöst, wolle uns das Resultat persönlich mitteilen – und unbedingt wissen, woher der Kunststoff stammte.
Am nächsten Morgen frühstückte ich um Viertel vor neun in trauter Zweisamkeit mit Admiral Nelson, der mir wie gewohnt mit blitzschnellen Pfotenwischern noch nicht aufgeweichte Corn Flakes aus der Schüssel stibitzte und glückselig die restliche Milch schlabberte. Schon um halb zehn holte ich Laxmi in Kensington ab, denn wir wollten uns unter keinen Umständen verspäten und den Termin verpassen. Dazu war er zu bedeutsam. Und man wusste ja nie, wie lange man wo auf der Autobahn steckenblieb.
Wir kamen zwar überraschend gut aus der Londoner Innenstadt heraus – nicht mal in Earls Court oder auf der Cromwell Road gab es Staus. Es erwischte uns erst am Chiswick Flyover, wo die A4 in die Autobahn M4 mündet, am Übergang der M4 in die M25 und an deren Vereinigung mit der M40. Das Übliche eben, kein Lkw–Unfall mit Vollsperrung oder ähnliches. Deshalb waren wir viel zu früh in Oxford – von meiner Wohnung in Chelsea war es ja auch nur ein Katzensprung von sechzig Meilen.
So bummelten wir eine Stunde durch das Städtchen, das teilweise einem mittelalterlichen Freilichtmuseum gleicht, schlürften einen italienischen Espresso und bewunderten dann die Säulenhallen und die tempelartigen Gebäude des Christ Church College, wo Professor Hoare residierte und als Tutor wirkte. Pünktlich holte er uns an der malerischen Pforte ab und führte uns durch einen prachtvollen Innenhof, eine Reihe altehrwürdiger Klostergänge und über mehrere Schnörkeltreppen in sein bis auf Rechner, Drucker und Scanner gleichfalls museumsreifes Studierzimmer.
Ich hatte mit einem streng vergeistigten, weißhaarigen Hutzelmännchen gerechnet und war überrascht, wie jung Hoare war. Er sah eher wie ein ewiger Student aus denn wie ein renommierter Lehrstuhlinhaber, war mit knapp 40 höchstens drei Jahre älter als ich, etwa 1,85 m groß und sportlich. Er trug verwaschene Jeans, ein weißes Hemd ohne Schlips und einen marineblauen Blazer mit Goldknöpfen, hatte einen schwarzen Lockenkopf, muntere dunkle Augen und lachte viel. Die Studentinnen schmolzen sicher vor ihm dahin wie Vanilleeis im Backofen.
Hoare machte Tee und schenkte uns ein. Dann wurde er ernst. »Was sie mir da zur Untersuchung geschickt haben«, sagte er gewichtig und schaute Laxmi an, »war gar nicht einfach zu analysieren. Wir haben erstklassige Leute am Institut für organische Chemie und die besten Geräte, aber solch ein Polymer hat noch keiner von uns zu Gesicht bekommen. Wir waren drauf und dran, die Flinte ins Korn zu werfen, aber dann haben wir es doch geschafft. Das Material ist nämlich extrem – äh«, er suchte nach einem Wort, «äh, ungewöhnlich, und zwar eher physikalisch als chemisch!« Er machte eine Pause und schaute uns beide an. »Ich würde zu gern wissen, wie sie an die Substanz gekommen sind.«
Bevor ich etwas sagen konnte, fuhr Hoare fort. »Aber lassen Sie mich zuerst berichten, was wir entdeckt haben. Für Sie, Mr. Cunningham«, – er warf mir einen raschen Blick zu – »werde ich versuchen, die chemischen Fakten so leicht fasslich wie möglich darzustellen. Aber die Vereinfachung hat natürlich Grenzen.«
»Also,« der Professor nahm einen Schluck aus seiner Teetasse, »viele Kunststoffe entstehen durch einen Prozess, den wir Polymerisation nennen. Dabei fügen sich, meist mit ein wenig technischer Nachhilfe, niedermolekulare chemische Bausteine, sogenannte Monomere, zu langen Ketten zusammen. Beim PVC, dem allgegenwärtigen Polyvinylchlorid, sind das beispielsweise viele Moleküle von Vinylchlorid. Die Vorsilbe ‚Poly’ kommt aus dem Griechischen und heißt viel. Aus vielen VC–Molekülen wird also durch Polymerisation ein PVC–Makromolekül, oder, wie wir sagen, ein Polymer.
Je nachdem, wie ihre Moleküle Händchen halten, können Polymere verschiedene Molekülstrukturen haben – vor allem lineare, verzweigte oder vernetzte. Ist an der Polymerisation nicht nur eine Art von Molekülen beteiligt, sondern sind es zwei oder mehr, nennen wir das ein Copolymer. Auch hier gibt es wiederum eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie sich die Grundbausteine der beiden Komponenten – nennen wir sie einmal A und B – im Makromolekül räumlich anordnen. Da haben wir beispielsweise die sogenannten alternierenden Copolymere, bei denen, wie der Name schon sagt, die beiden Bausteine abwechselnd aufgereiht sind, nach dem Schema ABABAB.
Von besonderem Interesse ist heute für uns ein anderes Molekülmuster, das der sogenannten Pfropfencopolymere. Das sind verzweigte Polymere, bei denen die Hauptkette ausschließlich aus dem einen Grundbaustein, die Nebenkette aber aus dem anderen besteht.« Hoare nippte an seiner Tasse.
»Bei ihrer Probe handelt es sich um ein Pfropfencopolymer aus zwei sogenannten Polymethacrylaten, und zwar um Polymetacrylsäuremethylester, Kürzel PMMA, und Polymetacrylsäurepropylester, abgekürzt PMAP.« Hoare sah mich entschuldigend an. »Beide Polymere bilden ein absolut gleichmäßiges Netz, und sie haben einen identischen Polymerisationsgrad von 645 000. Das bedeutet, dass alle Ketten sehr lang sind – und dazu absolut gleich lang.« Der Professor schüttelte den Kopf, als könne er es nicht glauben.
»Die regelmäßig vernetzte Molekülstruktur des Copolymers aus PMMA und PMAP und sein extrem hoher Polymerisationsgrad bringen für den Werkstoff zahlreiche Vorteile mit sich: Kristallinität, Dichte und mechanische Festigkeit sind höher und die Thermostabilität besser. Die Substanz ist transparent, sehr hart, unzerbrechlich, gegen ultraviolette Strahlen unempfindlich, bis 95 Grad temperaturbeständig, und sie wird weder von Wasser, noch von Säuren, Laugen, Benzin oder Alkohol angegriffen.«
Читать дальше