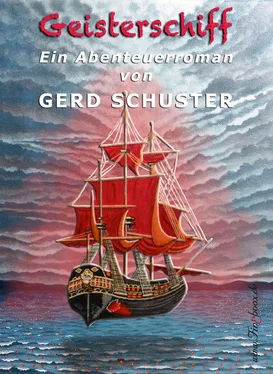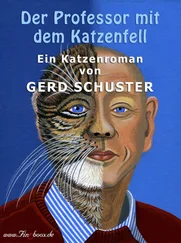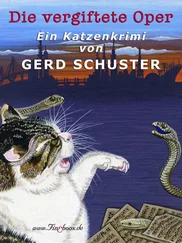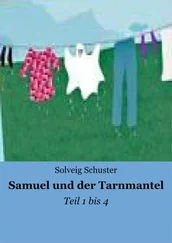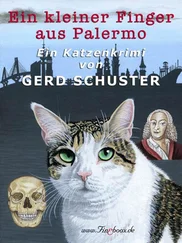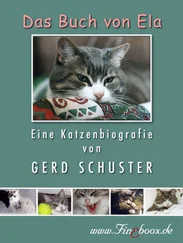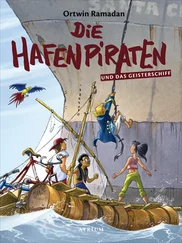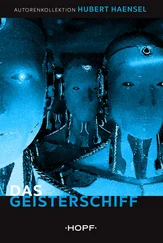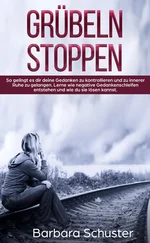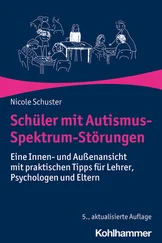1 ...8 9 10 12 13 14 ...24 Sie gab mir einen kleinen Kuss auf die Wange und fuhr mir mit ihren langen schlanken Fingern zärtlich durchs Haar. Das beruhigte ungemein. Aber sobald sie damit aufhörte, begann ich wieder zu grübeln. Was war, wenn der elefantenköpfige Gott nicht zu mir, sondern zu Hamish Hogg hielt – aus Solidarität unter Übergewichtigen? Oder wenn der Dicke den Fall schon gelöst hatte? Wenn gleich das Handy klingelte und mich Michael Morris von Lloyds auslachte?
Laxmi erriet meine Gedanken. Sie gab mir einen Klaps und sagte: »Ganesha hält dich nicht zum Narren. Er ist nicht falsch. Er hat dir ein mentales Bild geschickt, und du hast die Fluke, die er dir gezeigt hat, aus dem Meer gezogen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du sie finden würdest, war geringer als die eines Volltreffers im Lotto. Er hat dir ihre Position gezeigt und dafür gesorgt, dass du mit einem Fischer rausfährst, der sein Netz auswirft. Das war ein Riesenhaufen Glück, und der Fund muss einen Sinn haben – welchen, kriegen wir noch raus. Er hat dir geholfen, und er wird dir weiter helfen.«
Wir kuschelten zwanzig Minuten, ohne etwas zu sagen. Admiral Nelson war ins Bett gekrochen und schmiegte sich an Laxmis Oberschenkel. Er war durch und durch Ästhet. Ich dachte über die Worte meiner Prinzessin nach. Meistens hatte sie ja recht, auch wenn es mir manchmal schwer fiel, mir – und ihr – das einzugestehen.
»Jim?«, flüsterte sie schließlich. »Darf ich noch etwas sagen?« »Aber natürlich!«, antwortete ich. Was wohl jetzt kam? «Mit Ganeshas Beistand«, sagte sie, »hast du ein Teil einer Galionsfigur gefunden. Aber was weißt du über Galionsfiguren? Meinst du nicht, er will, dass du dich informierst?«
Ich war verblüfft. Es lag so nahe, aber ich hatte nicht daran gedacht. Laxmi hatte recht: Ich wusste über Galionsfiguren nur, dass sie früher am Bug von Segelschiffen befestigt worden waren. Ich hatte so wenig Ahnung, dass ich nicht mal wusste, was es über sie zu wissen gab. Damn, es war gut möglich, dass ich Ganeshas Fingerzeig nicht verstand, weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte.
Ich packte Laxmi, zog sie auf mich und drückte sie. Verärgert über die Ruhestörung hechtete Admiral Nelson aus dem Bett. »Prinzessin aus dem Morgenland, du bist ein Schatz!«, sagte ich. »Was würde der bekannte Ermittler Jim Cunningham von MIA ohne dich anfangen? Er müsste bei Burger King Pommes frites eintüten oder im Oberhaus Maulaffen feilhalten – was beides ähnlich unerfreulich ist! Morgen gehe ich ins British Museum!«
Natürlich hätte ich auch im Internet surfen können, aber mir war nach »richtigem« Lesen in echten Büchern aus angegilbtem Papier zumute, die würzig nach altmodischer Gelehrsamkeit, viktorianischer Schicklichkeit und längst vergangener Gründlichkeit rochen. Ihnen entwich eine besondere Art von Staub, der auf ganz eigentümliche Art und Weise in der Nase kitzelte – so, als wolle er das Hirn anregen. Es gab kaum einen Ort in der Welt, wo man sich in edlerer und feinsinnigerer Atmosphäre bilden konnte.
Auf jeden Fall war diese Art der Bildung erfreulicher, als sich im Internet, permanent von Pop–up–Werbung belästigt und von einem aufmerksamkeitsheischenden Sieben–Kilo–Kater bedrängt, durch unzählige besserwisserische, halbwahre oder komplett schwachsinnige Beiträge zu arbeiten. Die aber waren mir sicher, wenn ich als Suchwort »Seejungfrau« eingab.
So stand ich am nächsten Tag um fünf vor zehn mitten in einem schnatternden Schwarm japanischer Touristen vor dem Haupteingang des British Museum in der Great Russell Street und harrte auf Einlass. Ich ging schnurstracks in den Lesesaal – und blieb geblendet stehen.
Die riesige Kuppelhalle war seit meinem letzten Besuch renoviert worden und erstrahlte in beinahe indischer Pracht. Über den drei Stockwerke hohen Bücherregalen thronten die neugotischen Kathedralenfenster. Von ihnen strebten viele schmale Dekorsegmente wie die Blütenblätter einer monumentalen geschlossenen Kugelblume himmelwärts zu dem großen runden Oberlicht im Kuppelzentrum. Alles war in den Farben Vergissmeinnichtblau, Kondensmilchbeige und Gold gehalten.
Diesen Tempel des Wissens »Reading Room« (Lesezimmer) zu nennen, war ein Superlativ britischer Untertreibungssucht.
Am zentralen Service Desk, einem Arrangement von halbrunden Schaltersegmenten, die zusammen drei konzentrische Kreise bildeten, bestellte ich Literatur zum Thema Galionsfiguren. Mit drei Wälzern setzte ich mich an einen der Lesetische, an denen – als hier noch die British Library untergebracht war – Gandhi, Lenin, Kipling, Marx, Wells und viele andere Größen der Weltgeschichte studiert hatten. Vielleicht auf dem gleichen Platz.
Die Bücher waren dermaßen interessant, dass ich kurz vor halb sechs Uhr abends von einem höflichen Mitarbeiter des Lesesaals daran erinnert werden musste, dass der Reading Room schloss. Ich hatte fünf Bücher über die Geschichte der Seefahrt und zwei Bildbände voller Galionsfiguren durchgearbeitet und mir fünfzehn Seiten Notizen gemacht. Ich fuhr sofort nach Hause und tippte, obwohl halb verhungert und verdurstet, eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte in den Computer.
Das Wort Galionsfigur kam vom spanischen Galion (Balkon) und bezog sich auf einen balkonähnlichen Vorbau am Bug, den verschiedene Arten von Segelschiffen zeitweilig besessen hatten. An ihm war oft die Galionsfigur befestigt gewesen.
Es gab Galionsfiguren, seit Menschen zur See fuhren. Ihre Vorläufer waren Augen, die chinesische Schiffer viele Tausend Jahre vor Christus an den Bug gemalt hatten, weil sie ihre Segler als lebende Wesen betrachteten und glaubten, sie benötigten Augen, um ihren Weg durch die Wasserwüste der weitgehend unbekannten Meere zu finden. In vielen Teilen Asiens gab es bis heute keinen Fischerbootsbug – und keine LKW–Motorhaube – ohne Augen.
Die alten Ägypter waren weiter gegangen: Sie hatten ihre Barken in die Obhut scharfäugiger heiliger Vögel gegeben, die am Schiffsschnabel Ausschau gehalten hatten. Die Phönizier hatten den Bug ihrer Galeeren mit Pferdeköpfen, hölzernen Götterstatuen, geschnitzten Ebern, Löwen und Schlangen verziert. Man hatte gehofft, die Kraft und Schnelligkeit, Orientierungsgabe, Wehrhaftigkeit und List dieser Tiere auf das Schiff übertragen zu können und den Segen der Götter auf es zu ziehen.
Nicht anders waren die Griechen, Römer und Karthager verfahren. Sie alle waren überzeugt gewesen, die Galionsfiguren könnten die Wind– und Wassergeister besänftigen, das Schiff vor Sturm, Untiefen und Feinden schützen und es wohlbehalten in den Heimathafen zurückleiten.
Die Boote der Wikinger und Normannen hatten Köpfe von Drachen, Stieren und Seeschlangen vor sich hergetragen. Sie sollten Feinde erschrecken und deren Schutzgeister in die Flucht schlagen.
Damals und auch in späteren Jahrhunderten hatten die Seeleute fest an die Zauberkräfte der Galionsfiguren geglaubt. Es gingen so viele Segler auf den Meeren verloren, dass den Matrosen nur ihr Aberglaube den Mut gegeben hatte, immer wieder anzuheuern und ihr Leben zu riskieren.
Die Galionsfigur war »Seele«, Schutzengel und Identitätssymbol jedes Schiffes gewesen – und sein guter Geist. Die Crews hatten die Schnitzwerke manchmal beim Stapellauf mit Wein »getauft«, auf See mit ihnen gesprochen, sie um mehr oder weniger Wind gebeten, und sich um ihr Wohl gesorgt. Es war vorgekommen, dass Matrosen nach dem Stranden ihres Schiffes oder vor einer Selbstversenkung mitten in einer Seeschlacht unter Einsatz ihres Lebens die Galionsfigur geborgen hatten. Denn eine Beschädigung oder der Verlust des Schutzpatrons war ein böses Omen und bedeutete Untergang, Leid und Tod.
Als 1794 in einem Seegefecht mit französischen Einheiten der Galionsfigur der britischen Fregatte »Brunswick«, die den Herzog von Braunschweig im Schottenrock darstellte, der Hut vom Kopf geschossen wurde, geriet die Mannschaft in Panik. Eilig setzte man der barhäuptigen Holzfigur den Galahut des Kapitäns auf – und gewann das Gefecht.
Читать дальше