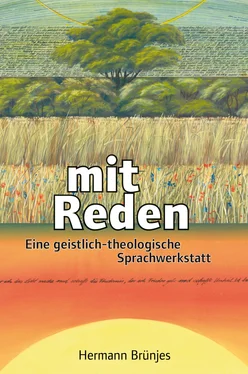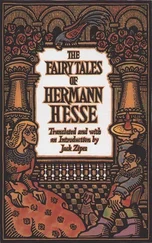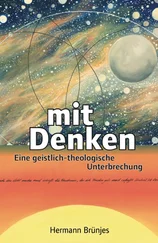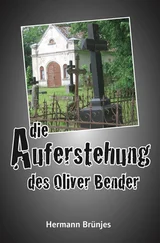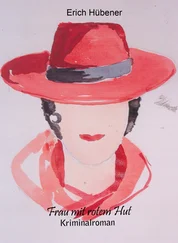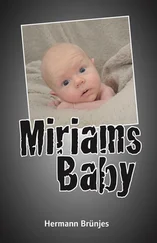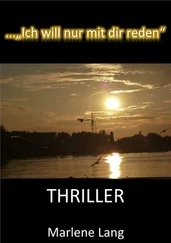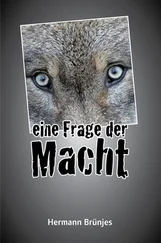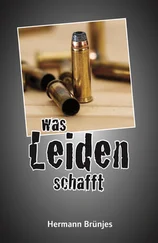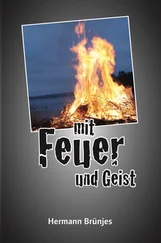Was mögen das damals für Leute gewesen sein? Nur ein paar Fromme und Gläubige? Jene, die sich schon immer für Religion interessierten, die Insider? Nein. Es waren Menschen aus allen Bereichen in Jerusalem. Beamte, Gelehrte, Handwerker, Hausfrauen, Soldaten, Sklaven, Politiker und Händler, Junge und Alte, Kluge und Dumme, Dicke und Dünne ... die Verschiedenheit der Schawout-Gemeinde war enorm. Viele tausend Menschen aus der damals bekannten Welt belebten die Straßen. Es gab keine wirklich übergreifend verbindende Sprache, wie es heute Englisch ist. Die Meisten mögen als geborene oder auch übergetretene Juden zumindest etwas Hebräisch gekonnt haben. Immerhin waren sie in Jerusalem, weil sie die Tora, die jüdische Bibel (Teile des Alten Testaments), das von Gott offenbarte Wort feiern wollten. Latein war im römischen Reich primär unter Gebildeten und Angehörigen des Rates verbreitet, auch Griechisch wurde von manchen gesprochen – aber die meisten sprachen und beherrschten vor allem oder sogar ausschließlich ihre Mutter- und Landessprache.
Babylon lässt grüßen!
Doch Babylon hat keine Chance gegen Pfingsten.
Da ist von einem Brausen und Wind die Rede, es sieht aus wie Feuerflammen (V. 3). Das »Wunder« jedoch bleibt unsichtbar. Es wird nicht mit dem Auge, sondern mit dem Ohr wahrgenommen. Die Leute verstehen, was diese merkwürdig aufgeheizten Christusleute reden. (V. 6-11).
Das Wort verstehen
Wegen der Tora feiern sie dieses Fest – das Wort Gottes erreicht sie jetzt mit einer Botschaft, die ihre alte in neuem Licht erscheinen lässt. Auf das Alte folgt das Neue Testament Gottes. Es wird geprägt von einem Namen: Jesus Christus. Um ihn geht es in den Pfingstpredigten. Er ist auferstanden und hat den Tod besiegt. Er ist Gottes letztes verbindliches Wort und interpretiert auch die Tora.
Und die Jesusbotschaft wird seit Pfingsten verstanden?
Babylon ist wirklich vorbei?
Schaut man auf die Reaktion nach dem ersten Brausen und den mutigen Reden der Jüngerschar, so wird zu Pfingsten mit dem Hörwunder noch keineswegs ein umfassendes Glaubenswunder eingeleitet. Einige sind irritiert und verwirrt. »Was soll das werden?« (V. 12). Sind die nun völlig abgedreht? Welcher Trick mag dahinterstecken? Andere kommen schnell zum Schluss, dass solche Typen betrunken sein müssen. »Sie sind voll des süßen Weins!« (V. 13). Vielleicht meinen sie auch den Rausch der weltfremden Hoffnungsworte, dem sich diese Christenleute hingeben. Wenn man ständig von Liebe redet, von Vergebung, von Frieden, von Gemeinschaft und sinnvollem Leben, von Gottes Weltherrschaft und seiner Menschwerdung, dann sind das für manche Zeitgenossen einfach nur »süße Worte«, die nur jemand verbreiten kann, der eine rosarote Brille trägt und der wahren Welt und den wirklich wichtigen Fragen im Rausch entflieht.
Pfingsten war also trotz (oder sogar wegen?) des Rede- und Hörwunders zunächst kein Erfolg. Babylon mit Sprachverwirrung und Nichtverstehen sitzt zu tief, als dass es mal eben so überwunden wird. Das schaffen weder tolle Predigten noch große Gefühle. Ein Event mit Flammen, Rauschen und viel Gedröhn, kann vielleicht inszeniert werden – ob Gott sich darin wirklich offenbart, bleibt jedoch völlig offen.
Dann jedoch verändert sich die Szene. Simon, ein einfacher Fischer mit Rufnamen Petrus, meldet sich zu Wort. Nicht mehr die Gelehrten und Studierten sind Interpreten und Überbringer des mächtigen Gotteswortes, sondern einfache Leute, Laien, Amateure. Seine Botschaft zeigt Wirkung.
Was macht Petrus? Er deutet das, was alle eben erlebt haben. Er predigt sachlich und rational. Er erklärt, argumentiert, erzählt, berichtet, klärt auf. »Nein, sie sind nicht betrunken. Es ist ja auch erst früh morgens.« (V. 15) »Was hier passiert ist vielmehr das, was ihr beim Propheten Joel gelesen habt.« (V. 16) Dann malt er Jesus Christus als Erfüller und Ziel der Tora vor Augen. Die meisten Anwesenden waren mit der Sehnsucht nach Gottes Offenbarung nach Jerusalem gekommen – nun erfüllt sich diese Sehnsucht in und durch Jesus, den Auferstandenen, vor ihren Augen.
Interessant: Nicht das tosende, flammende und geheimnisvolle Pfingstereignis führt zum Durchbruch der Botschaft von Jesus Christus, sondern die eher nüchterne Predigt des Petrus. Wo zunächst nur Staunen war, folgt jetzt Verstehen.
Wir tun also gut daran, bei der Suche nach Worten und Weisen der Verkündigung ein gutes Maß an Nüchternheit und Sachlichkeit zu bewahren. Petrus predigt reflektiert, auf die alten Schriften bezogen und gleichzeitig geht er auf seine Zuhörer ein. Eine »Sprachschule des Glaubens« mag gerne auch emotional geprägt sein – ihr Wesen ist jedoch eher ein rationaler Umgang mit Sprache, Worten und dem Wort Gottes.
Ich weiß, manche Geschwister aus Pfingstkirchen sehen das anders. Da werden möglicherweise die Begleitphänomene damaliger Verkündigung in den Vordergrund gerückt: Sprachengebet, Zungenrede, Prophetie, Heilungen ...
Auch wenn sie vieles völlig anders sehen und sich von einer pfingstlerischen Theologie und Praxis abgrenzen, bewerten auch Großkirchen und oft auch moderne Missionsbewegungen die Bedeutung der das Wort begleitender Phänomene oft extrem hoch. Da wird auf die Wirkung von Riten und traditionellen Zeremonien gesetzt oder auf mitreißende Musik und begeisterndes Entertainment. Die Verkündigung wird inszeniert. Sowohl die katholische Kirche als auch amerikanische Missionsbewegungen sind Meister darin. Je besser die Inszenierung gelingt, desto eher erwarten wir, dass die Botschaft ankommt. An Stelle der überrationalen Charismen treten jetzt Begabungen, Fähigkeiten, Redekunst (Rhetorik) und eine professionell gemachte Eventkultur.
Doch es ergeht uns wie Pfingsten.
All dies bleibt mit Blick auf »Verstehen« hinter der klaren und sachlichen Rede zurück. Ja, wir brauchen »Zeichen«, die uns zum Staunen bringen oder auch uns provozieren und so ins Nachdenken führen. Wir brauchen eine gute und angenehme Atmosphäre, Erlebnisse, Emotionen und verbindende Gemeinschaftsgefühle. Was wir jedoch vor allem brauchen, sind Worte, die von den Menschen verstanden werden.
Eine Werkstatt wie diese ist also sehr hilfreich.
Allerdings, und wieder differenziere ich, weil auch geistliche Prozesse nicht so oder so verlaufen: Genau betrachtet bewirkt auch das klare, nüchterne und verständliche Wort der Verkündigung nicht, was Pfingsten tatsächlich geschieht. So wenig wie die begleitenden Zeichen, so wenig sind es die Worte der Petruspredigt, die letztlich den Ausschlag zur ersten Gemeinde geben (Apg. 2,37-47). Was steht dort genau?
»Es wurden hinzugetan« (V. 41) und später »der Herr tat hinzu« (V. 47). Was gemeint ist, liegt auf der Hand: Nicht das Pfingsterlebnis und auch nicht unmittelbar die Predigt des Petrus haben die Leute erreicht. Auch nicht die Entscheidung der Leute, sich taufen zu lassen, war der Grund des Erfolges. Nein, Gott selbst hat dies gewirkt. Er hat gehandelt und die Menschen zum Glauben und in die Gemeinde geführt. ER hat Verstehen geschenkt.
Die Abhängigkeit allen (kirchlichen) Handelns vom Geist Gottes wird wieder sichtbar. Weil dies so wichtig und dennoch oft vergessen wird, habe ich davon schon im Vorwort geschrieben. Alle Verkündigung, jedes Wort über meinen Glauben, Gott und was mir da so wichtig ist, kann nur »ankommen«, wenn Gottes Geist es den Leuten »ins Herz« (V. 37) pflanzt. Die Grundhaltung der Verkündigung kann deshalb nur eine von Demut gekennzeichnete Gebetshaltung sein.
Gottes Geist erwarten
Warum schreibe ich nicht »den Geist erbitten ?«
Die Frage ist berechtigt. Wenn die Grundhaltung der Verkündigung ist, dass nur Gott selbst unserer Worte Kraft und Wirkung zu geben in der Lage ist, werden wir um seinen Geist bitten. Das Gebet um Vollmacht und Gottes Eingreifen begleitet uns Christen auch und besonders dann, wenn es um das mit Reden geht, um Sprache und Verkündigung. Ohne Gottes Geist der Liebe können wir »mit Menschen und Engelszungen reden« und wären doch letztlich »ein tönend Erz und eine klingende Schelle!« (1. Kor. 13,1).
Читать дальше