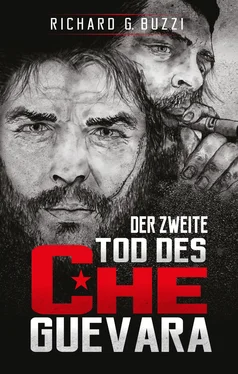Lewis Norman war das, was man einen guten Amerikaner nannte. Und als solcher ging er jeden Sonntag in die Kirche. Greg und sein Bruder mussten sich dafür unter den Augen der indianischen Nachbarskinder fein herausputzen. Vater Lewis erhoffte sich dadurch einen Nachahmungseffekt, um auf diese Art und Weise neue Schäfchen für die Glaubensgemeinde zu rekrutieren. „Unsere Aufgabe muss es auch sein, die Indianer auf den rechten Weg zu bringen und ihnen die Güte Gottes vor Augen zu halten“, sagte er seiner Familie, die dem missionarischen Eifer ihres Ernährers nur widerwillig Folge leistete.
Greg entwickelte schon früh eine tiefgreifende Aversion gegen die Kirche und seine indianischen Spielkameraden. Er hatte dem Gespött der wilden Rabauken, die sich über sein zartes Wesen und den kirchlichen Sonntagsanzug lustig machten, nichts anders entgegenzusetzen, als seine grenzenlose Verachtung. Und diese zielte besonders auf jene Kinder, die er für zu dick hielt.
„Hey Adlerfeder, heute schon Atemstillstand gehabt?“, fragte er jeden Morgen den Nachbarsjungen Francis Miller, wenn dieser aus dem Haus kam. Francis wog mit zwölf Jahren satte 60 Kilo. In den Augen von Greg war Francis Adlerfeder Miller das Sinnbild des dicken und faulen Indianers und er konnte nicht verstehen, warum sein Vater sich bei der Regierung in Washington ausgerechnet für diese Menschen einsetzte und für sie Hilfsprogramme auf den Weg brachte.
Gregs Lage war aus zweierlei Gründen äußerst misslich: Francis Adlerfeder Miller war trotz seiner Leibesfülle der Anführer einer kleinen Gang, die tagsüber durch das Grasland strich und Jagd nach wilden Tieren machte. Der schwächliche Greg wurde davon stets ausgeschlossen, für die Gangmitglieder war er ein stinkender Yankee, der in ihrer Mitte nichts zu suchen hatte. Wann immer Greg einem der Gangmitglieder über den Weg lief, bekam er Prügel oder musste wüste Beschimpfungen über sich ergehen lassen. Diese Tatsache allein hätte Greg noch ertragen, aber dass sein Bruder Jeff auf der Seite der Indianer stand und mit ihnen die Lagerfeuerromantik teilte, war nicht auszuhalten.
Daher war es nicht weiter verwunderlich, dass Greg sich als Außenseiter fühlte und zum Lonesome Cowboy heranwuchs, obwohl er auch diese Gattung von Individuen hasste wie die Pest - war das Schicksal der Cowboys doch eng mit dem der Indianer verknüpft.
Greg träumte von der großen, modernen Welt mit ihren Hochhäusern und pulsierenden Straßen, auf denen das ausschweifende Leben tobte. Nur weit weg von Wildwestromantik, Büffeldung und Pferdeschweiß. Die Stadt seiner Träume war New York. Er kannte die Stadt lediglich von Fotos, die er sammelte. Schon als kleiner Junge lernte er die Namen der Hochhäuser, Brücken und Straßen auswendig. New York schien ihm die angemessene Alternative zu Rapid City zu sein. Schon das Wort allein war Musik in seinen Ohren. New York, das hörte sich an wie Rock und Pop mit großem Streichorchester.
Lewis Norman hatte für die Pläne seines Sohnes lediglich ein Lächeln übrig. „Übe dich besser in Nächstenliebe und reiche den Indianerkindern die Hand der Versöhnung“, war die Standardpredigt seines Vaters. „Gott erhört und belohnt nur jene Menschen, die nach seinem Wort und seinem Willen leben.“
Es war ein Donnerstag im April, als der Gott von Lewis Norman ausgerechnet dieses Gesetz außer Kraft setzte. An diesem Tag wurde die Leiche des gläubigen Familienvaters gefunden, im Gesicht des Toten klaffte ein großes Loch.
„Der Regierungsbeamte Lewis Norman muss aus nächster Nähe erschossen worden sein“, hieß es später im Polizeibericht. Greg konnte sich noch gut erinnern, wie die Polizei ins Haus kam und ihnen die traurige Nachricht überbrachte. Seine Mutter blieb erstaunlich gefasst und weinte nur still.
Auch Greg empfand keine allzu große Trauer. Er hatte seinen Vater stets für sämtliche Widrigkeiten des Lebens verantwortlich gemacht. Nicht, dass er ihn hasste, aber er war ihm gegenüber mit den Jahren gleichgültig geworden.
Greg hatte sich einen anderen Vater gewünscht, einen besseren, wie er meinte. Er fühlte sich missverstanden und ungeliebt. Greg wollte einen Vater, der ihn beschützte und tröstete, sollten ihm die Probleme wieder einmal über den Kopf wachsen. Nicht einen, der ständig von Gott als Erlöser und Retter sprach, sondern einen, der die Indianerkinder am Kragen packte, um ihnen die Leviten zu lesen. Greg wünschte sich einen Dad mit Muskeln, einen starken Mann, wie der junge Automechaniker an der Tankstelle einer war. Greg beobachtete ihn jedes Mal ehrfurchtsvoll, wenn er in die Stadt kam.
Tommy, so hieß der Dad seiner Träume, war groß und kräftig. Seine Oberarmmuskeln wölbten sich zu erhabenen Bergen, wenn er Autoreifen und Stahlfelgen in die Höhe wuchtete. Unter dem ölverschmierten T-Shirt zeichneten sich die Bauchmuskeln ab.
„Warum hast du nicht Tommy geheiratet?“, wollte Greg von seiner Mutter wissen. Luise Norman war jedes Mal peinlich berührt und um eine Antwort verlegen. „Versündige dich nicht!“, sagte sie lediglich. „Du sollst Vater und Mutter ehren, steht in der Bibel, hast du das vergessen?“
„Nein, aber wie soll ich meinen Dad ehren, wenn er mich nicht gegen die Indianer beschützt?“
„Greg, rede nicht solchen Unsinn. Du bist sofort still, sonst muss ich deinem Vater davon erzählen.“
„Wenn ich groß bin, habe ich so viele Muskeln wie Tommy und werde meine Kinder gegen jeden dicken Indianer verteidigen. Das kann Vater ruhig wissen.“
In seiner kindlichen Phantasie ließ Greg seinen schmächtigen Dad jeden Sonntag in der Kirche sterben. Er stellte sich bildlich vor, wie dieser nach der Einnahme des Heiligen Abendmahls zu röcheln begann und blau anlief. Er griff sich an die Kehle und fiel vor dem Altar tot um. Jemand hatte den Wein und die Hostie vergiftet. Während sein Vater zu Boden fiel, riss er den Pfarrer mit um. Der schlug mit dem Kopf auf den Steinboden und starb an derselben Stelle.
Die Trauer des kleinen Greg hielt sich deshalb in Grenzen, als er vom Tod seines Vaters erfuhr. Er fühlte sich eher von einer Last befreit und hoffte, dass seine Mutter jetzt mit ihm nach New York ziehen würde. Sein Bruder Jeff könnte in South Dakota bleiben.
„Wer hat meinen Mann getötet?“, fragte Luise Norman den Polizisten.
„Das wissen wir noch nicht. Das FBI ist am Tatort und untersucht die Umgebung nach brauchbaren Spuren.“
„Es war ein dicker, betrunkener Indianer“, sagte Greg.
„Was fällt dir ein, mein Junge“, schluchzte seine Mutter. „Keiner unserer Freunde hätte deinem Vater auch nur ein Haar gekrümmt.“
„Es war ein dicker fetter Indianer“, wiederholte Greg mit trotziger Stimme.
„Greg!“
Der Polizist blickte verwirrt auf die Familie des erschossenen Regierungsbeamten.
„Ich habe den Vater von Francis Adlerfeder Miller im Verdacht. Es war ein Racheakt“, sagte Greg mit trotziger Stimme.
„Wie kommst du darauf?“, fragte der Polizist, dem die Situation immer peinlicher wurde.
„Ich habe Francis ständig wegen seines Übergewichts beleidigt. Ich würde an Ihrer Stelle seinen Vater fragen, ob er das Gewehr besitzt, mit dem mein Vater erschossen wurde. Es würde mich nicht wundern, wenn Sie die Knarre bei ihm finden.“
„Greg!“, rief die Mutter abermals.
Der Polizist trat verlegen von einem Bein auf das andere. „Ich muss mich jetzt leider verabschieden“, meinte er. „Sollten Sie noch Fragen haben, Frau Norman, rufen Sie mich im Revier an.“ Mit diesen Worten verließ er eiligen Schrittes das Haus.
„Vergessen sie meinen Hinweis nicht“, rief ihm Greg nach. „Der Kerl heißt Miller und wohnt gleich neben an.“
Die Leiche von Gregs Vater wurde nahe der Gedenkstätte von Wounded Knee gefunden, wo Ende des 19. Jahrhunderts das letzte große Massaker an den Indianern stattgefunden hatte. Am 29. Dezember 1890 erschossen Soldaten des 7. Kavallerieregiments 287 Menschen, darunter viele Frauen, Kinder und Alte.
Читать дальше