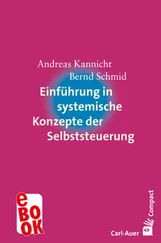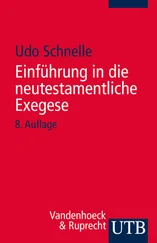Wie stark ist die konzeptionelle [[systematische Einheitsideale]] Einheit des Glücks? Diese Frage steht auch im Zentrum der Wahl zwischen dem aktiven und dem theoretischen Leben als exklusiven Lebensentwürfen. Man kann sich aber auch konkret das Leben eines Künstlers vorstellen, das kompromisslos der Kunst gewidmet ist. Für ihn ist das Leben eines Normalbürgers ,unzumutbar.‘ Nehmen wir an, dass das Leben des Normalbürgers aus entfremdeter Lohnarbeit und einem reichen Familienleben in der Freizeit besteht. Die Lohnarbeit langweilt ihn und führt dazu, dass viele künstlerische und intellektuelle Fähigkeiten verkümmern, aber sie stattet ihn mit genügend materiellem Wohlstand aus, damit er sich in der Freizeit seiner Familie widmen kann. Dem Künstler wäre ein solches Leben ein Graus. Die Bedingungen der Zumutbarkeit führen (nicht erst heute) zu einer Pluralität der Glücksinhalte: Eine philosophische Ethik darf weder dem Künstler ein normales Leben noch dem Normalbürger das Leben eines Künstlers zumuten. (Aufgrund einer Ethik Unangenehmes leiden zu müssen, ist doppeltes Leid.) Zumindest eine gewisse Vielfalt von (sich wechselseitig ausschließenden) Lebensentwürfen muss in Form von individuell geltenden Alternativen objektiv begründbar sein. (Kymlicka 1997, S. 154 f., 162 ff.; Nielsen 1973.)[< 22]
Es wird deutlich, dass man sich über das Verhältnis von [[Glück und Moral]] Glück und Moral klar werden muss. Der Hedonist sieht die Moral als glückswidrig, weil sie ihn zwingt, sich Lust zu versagen (Unvereinbarkeitsthese). Hedonisten in einem weiteren Sinne (also nicht „Lust,“ sondern „Freude“) können der Auffassung sein, dass das Glück mit der Moral vereinbar ist (Harmoniethese) oder dass es mit der Moral identisch ist (Koinzidenzthese). Diese Fragen können nur im Rahmen der Ausarbeitung einer bestimmten Ethik und einer mit ihr vereinbaren Sammlung an moralischen Normen, Regeln und Werten diskutiert werden. Hält man aber an einer Pluralität der Glücksinhalte fest, dann erscheint die Koinzidenzthese zu stark.
Man muss also die Frage nach der [[Reichweite der Ethik]] Reichweite der Ethik stellen. Denn eine Ethik scheint zwischen der hedonistischen Lust und der Moral zu stehen. Je nachdem, wie wir eine Ethik philosophisch konzipieren, stellt sich uns das Verhältnis zwischen dem motivierenden Genussleben und dem moralischen Leben anders dar. Für den französischen Maler Paul Gauguin war es vielleicht moralisch angemessen, Ende des 19. Jahrhunderts Frau und Kinder zu verlassen, um auf Tahiti zu malen und dort mit einem sehr jungen tahitianischen Mädchen zusammen zu leben.
1.4 |1.1 Das Leben als Streben nach dem Glück |1.2 Epistemische Probleme |1.3 Begründungstheoretische Probleme |1.4 Autarkie: Theoretische Glücksversprechen [< 10]
Autarkie: Theoretische Glücksversprechen
Einerseits ist das Leben kompliziert, andererseits ist das Glück auch Glückssache. Für Aristoteles ist das Glück aber etwas, das sich im Rahmen einer Ethik als „vollkommenes Gut“ bestimmen lässt. Wer glücklich ist, lebt [[Autarkie/Selbstgenügsamkeit]] selbstgenügsam (von griechisch autarkes). Selbstgenügsamkeit (griechisch autarkeia) ist für die antiken Ethiken zentral: Wer für sich das höchste, letzte, äußerste, vollkommenste ... Gut realisiert – also glücklich ist –, muss autark sein. (Vgl. Ackrill 1995
, Gurtler 2003.)
Das ist eine riskante Strategie antiker Philosophen. Denn wir hängen in unserem Glück – so wie wir Glück alltäglich verstehen – von [[Güter sind fragil]] äußeren Gütern ab. Wir haben Hunger und werden durch Essen satt. Aber an Essen kann es uns mangeln. Wir suchen Liebe und finden in vielfältigen sozialen Beziehungen Erfüllung. Aber Beziehungen können zerbrechen. Es gibt also sowohl natürliche als auch soziale Bedingungen des Glücks, die wir nicht (vollständig) unter Kontrolle haben. Wir sind offensichtlich im Bezug auf das Glück nicht vollkommen autark.
Es gibt zwei antike Philosophenschulen, die sich diesem Problem in besonderer Weise gewidmet haben. (Vgl. Forschner 1993.) Sie verfolgen ganz unterschiedliche Strategien. Die [[Die kynische Antwort]] Kyniker haben für eine radikale Reduzierung der Bedürfnisse plädiert. Sowohl in Bezug auf Nahrung als auch auf soziale Güter müssen wir demnach unsere Bedürfnisse re-[< 23]duzieren. Je einfacher unsere Bedürfnisse sind, desto eher können wir uns selber Befriedigung verschaffen: Wer auf Kaviar verzichtet, kann sich selbst in der Steppe Grütze herstellen. Wer auf Liebe verzichtet, kann seinen Sexualtrieb durch Onanie befriedigen. Wenn man das aus seiner persönlichen Sicht für erstrebenswert hält und wenn es zu einem passt, wird man jedenfalls leichter glücklich.
Die [[Die stoische Antwort]] Stoiker verfolgten eine andere Strategie: Sie gingen davon aus, dass man die Dinge nehmen muss, wie sie kommen. Wenn sie ausbleiben, muss man sich neu orientieren. Reichtum, Gesundheit, Ruhm, Ehre etc. können uns verfügbar sein. Wenn sie ausbleiben oder verloren gehen, gibt es andere Dinge, nach denen wir streben sollen (und können). Wir dürfen also niemals an den Gütern, nach denen wir streben, um ihrer selbst willen hängen. Wenn wir Kaviar haben, ist das in Ordnung, wenn nicht, kommen wir eben mit Grütze aus. Wenn eine geliebte Person stirbt, trauern wir kurz und orientieren uns dann neu. Absolute Bereitschaft zur materialen Neuorientierung ist Tugend. Handlungstheoretisch ist das problematisch, weil wir etwas nur dann wirklich intendieren, wenn wir an ihm als unserem einsichtigen Ziel hängen.
Es ist bisher nicht viel für eine philosophische Bestimmung des Glückskonzeptes gewonnen. Man kann aber abschließend ein paar Dinge fest halten: [[Der philosophische Glücksbegriff]] Glück ist als „Freude“ eine abstrakte Vorstellung über das Leben, insofern es subjektiv als gelingend und daher als lebenswert erscheinen würde. Diese Vorstellung lässt Handelnde ihre Situation im Lichte einer Konzeption des gelingenden Lebens sehen und wird so zu einem Maßstab für das Handeln. Sie ist zunächst intern verständlich (liefert Gründe) und im Idealfall rechtfertigt sie Personen im Lebensvollzug moralisch (liefert gute Gründe). Wie pluralistisch ist ein solches Konzept? Wie stark ist seine systematische Einheit? Wie komplex ist es intern? Eine konzeptionelle Klärung des Glücksbegriffes muss aufgrund der Konzentration auf diesen Begriff unvollständig bleiben, weil sich Antworten erst in einem spezifischen Ethikansatz finden lassen. Eigentlich erwartet man auf die Frage, was Glück ist, andere Antworten. Es ist fraglich, ob diese Erwartungshaltung philosophisch seriös ist.
Fragen und Anregungen
Überlegen Sie, welche Dinge für Sie zum Glücklichsein gehören. (a) Gibt es bei den Inhalten systematische Unterschiede? (b) Welche dieser Dinge sind wertende Erlebnisse?
Entwickeln Sie ein Konzept der Freude, das abstrakt ist (also nicht allein in Lusterlebnissen besteht) und dennoch ein Aspekt eines [< 24] „erfreulichen“ Lebens ist. Was bedeutet Freude in diesem Zusammenhang?
Aristoteles unterscheidet verschiedene Formen des Lebens (das genießerische, das praktische, das theoretische, das politische). Überlegen Sie, inwiefern sich diese Lebensformen substanziell unterscheiden? Wo liegen ihre Gegensätze? Wie hängen Sie zusammen?
Das Glück ist nach Aristoteles das Endziel des Handelns. Kritisieren Sie diese Grundthese seiner Ethik, indem Sie eine pluralistische Perspektive einnehmen.
Aristoteles unterscheidet herstellendes und vollziehendes Handeln (poiesis/praxis). Untersuchen Sie diese Unterscheidung kritisch.
Der Mensch wird von Aristoteles bestimmt als politisches Lebewesen. Die Ethiken des Hellenismus sahen im Glück ein autarkes – also selbstgenügsames – Leben. Machen Sie sich Gedanken darüber, wie man beide Leitlinien miteinander verbinden kann?
Читать дальше