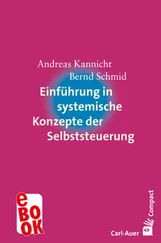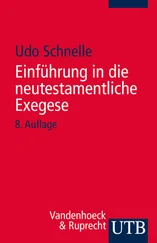Eine Konzeption des gelingenden Lebens ist zunächst nichts Besonderes. Sie ist eine Vorstellung des gelingenden Lebens, die aus einem Sammelsurium von Vorstellungen bestehen kann. Dieses Sammelsurium kann sehr systematisch sein. Eine solche „Vorstellung“ ist allerdings kein Erlebnis im psychischen Sinne, sondern ein Gegenstand [< 16] des reflexiven Denkens, insofern es eine Vorstellung als Ergebnis formt. Sie kann eine theoretische, romanhafte, poetische, ästhetische ... Einheit bilden. Dies würde die Redeweise „die Konzeption“ oder „die Vorstellung“ des gelingenden Lebens philosophisch rechtfertigen. Aber sie kann auch unschuldiger verstanden werden: Es ist eine Person, die handelt und sich vor sich und anderen verantwortet und der Welt Rechenschaft ablegt. Aus diesem handlungs- und begründungstheoretischen Individualismus, ist der Singular, der sich leicht einschleichenden Redeweise, philosophisch unproblematisch erklärbar.
Was könnte es nun heißen, wenn Aristoteles sagt, dass Personen in allen ihren Handlungen nach dem Glück streben? Man strebt nicht nach etwas Abstraktem. Handelnd müssen Personen konkret Erreichbares in Angriff nehmen. Unmittelbarer Sinn konstituiert Motivationen. Das Leben als Ganzes ist auch keine Handlung. Was für eine Handlungsanweisung geben Eltern ihren Kindern, wenn sie ihnen sagen „Kind, werde glücklich!“? Man kann aber nicht in einem Akt glücklich sein wollen. Ebenso wenig kann man es befehlen. Überdies intendiert man normalerweise im Alltag bewusst dieses oder jenes, aber kaum je Glück. Und Glück ist auch Glückssache; man kann es nicht handelnd, wollend, befehlend ... erzwingen. Will man die aristotelische These dennoch akzeptieren, muss man ihr philosophisch Sinn abgewinnen können.
Eine Analogie soll an dieser Stelle weiter helfen: Ein Arzt strebt nach [[Gesundheit als Ziel medizinischen Handelns.]] Gesundheit. Sofern er ein kompetenter und aufrichtiger Arzt ist, wird jede seiner beruflichen Handlungen auf Gesundheit hinzielen. Er wird Patienten verletzen (Spritzen geben, chirurgische Eingriffe vornehmen), vielleicht auch schwere Gifte verabreichen (Chemotherapie). Dies alles ist nicht verwerflich, sondern ärztliche Kunst, weil erkennbar ist, dass der Arzt letztlich nur die Gesundheit des Patienten erreichen möchte. Ärzte dürfen (die Zustimmung des Patienten vorausgesetzt) Dinge tun, die bei Nicht-Ärzten strafbewehrt sind. Manchmal verweigert der Arzt die Anwendung seiner ärztlichen Kunst. Er ist sicherlich auch gut darin, Sterbende sanft zu töten. Viele Ärzte lehnen aktive Sterbehilfe aber mit dem Verweis darauf ab, dass keine ihrer professionellen Handlungen in grundsätzlichem Gegensatz zum Streben des Arztes nach Gesundheit stehen darf, und nehmen an, dass aktive Sterbehilfe ihrem Berufsethos zuwider läuft.
Ärzte intendieren in der alltäglichen Praxis als Ärzte dieses oder jenes. Aber in gewissem Sinne ist „Gesundheit“ das eigentliche Ziel ihres beruflichen Tätigseins und es ist in jeder Handlung präsent. Es ist selbst dann noch handlungsleitend, wenn der Arzt Gesundheit nicht intendieren kann (z. B. weil es um einen Sterbenden geht oder er gerade diagnostische Maßnahmen durchführt). Wenn Personen also in jeder ih-[< 17]rer Handlungen und mit jedem Handlungstyp und in jedem Bereich des Handelns nach Glück streben, dann muss „Glück“ im Leben so etwas sein, wie „Gesundheit“ in der Medizin.
Aber in welcher Weise ist das [[(2) Etwas im Lichte einer Konzeption des gelingenden Lebens sehen]] Glück als Ziel in allen Handlungen präsent? Wenn „Gesundheit“ eine prägende Ordnungsstruktur der Medizin als einer sozialen Praxis zu sein scheint, so ist sie in dieser Handlungsstruktur präsent. Um eine Metapher zu benutzen, könnte man sagen: Alles Handeln in der Medizin geschieht im Lichte der Gesundheit. Zwar sind Gesundheit und Glück als Ziele des Handelns abstrakt, aber sie werden dadurch konkret, dass man sein Leben und die Handlungen in ihrem Lichte sieht. Wenn man aufgefordert wird, die Dinge seines Lebens in einem anderen Licht zu sehen, dann verändern sich unsere Motivationen zum Handeln oder die rechtfertigenden Gründe. Manchmal verändert sich so unser Leben. Unser Handeln im Lichte einer Konzeption des gelingenden Lebens zu sehen, bleibt jedoch kaum mehr als eine Metapher. Sie lässt sich mit Bezug auf Aristoteles etwas konkretisieren.
Aristoteles unterschied zwei grundsätzliche [[Verschiedene Lebensentwürfe als Glückskonzeptionen]] Lebensformen: das praktische und das theoretische Leben (griechisch bios praktikos und bios theoretikos). (Aristoteles 2011, 10.6-9, Kullmann 1995.) Das praktische Leben menschlicher Personen findet in einem alltäglichen sozialen Kontext statt. Der Bürger ist Politiker, aber er ist auch Arbeiter oder Arbeitgeber und er ist Familienmitglied, Freund. Ein gelingendes menschliches Leben umfasst viele unterschiedliche Rollen und Bereiche. Jeder folgt eigenen Gesetzmäßigkeiten. Es gibt viele unterschiedliche Lichtquellen im Leben. Es gibt viele unterschiedliche Lichtquellen im Leben. Wer ein virtuoser Musiker, ein eindrücklicher Maler, ein erfolgreicher Karrierist, ein mächtiger Politiker, ein innovativer Wissenschaftler oder ein Olympionike werden will, muss sich meditativ auf sein partielles Ziel konzentrieren, um gut zu sein.
Im praktischen Leben benötigt man viele Formen der Erkenntnis und Kompetenzen für viele Bereiche des menschlichen Handelns, um jeweils spezifische Rollen angemessen ausfüllen zu können. Für diese Pluralität bzw. Komplexität des menschlichen Lebens kann man nun die Wissenschaft (den akademischen Elfenbeinturm und die Grundlagenforschung) einerseits und das praktische Leben im aristotelischen Sinne als Familienmitglied in einem Freundeskreis und als Bürger-Politiker, Freizeitmusiker, Angler, ... andererseits beispielhaft untersuchen. (Das Ideal mancher Mönche ist: Bete und arbeite!) Beide Bereiche ergänzen sich ebenso, wie sie einander ausschließen.
Im Gang der Überlegungen ist die [[Was wählen? Muss man wählen?]] Frage nun: Muss man für das Glück im Leben ein praktisches oder ein theoretisches Leben wählen? Diese Frage ist aber mindestens eine dreifache: Muss man das eine (1) oder das andere (2) wählen und schließen sich beide wechselseitig aus [< 18] (3)? Jede Kultur kennt Lebenswege, die darauf beruhen, dass das Glück in einem an Komplexität reduzierten Leben besteht: meditierende Mönche, schöpferische Künstler, nachdenkliche und nachschauende Wissenschaftler. Reduzierte Lebensformen sind nötig. Nur wer sich konzentriert, macht etwas gut. Auch der Handwerker oder der Politiker muss sich konzentrieren. Aber jede reduzierte Lebensform setzt sich aufgrund der geringeren Komplexität der Gefahr aus, als verarmt zu gelten. Die dritte Frage ist notorisch schwer zu beantworten. Je restriktiver man sie beantwortet, desto exklusiver ist das Glück und desto weniger komplex ist die entsprechende Konzeption des gelingenden Lebens. Im dem Maße, wie man sie zu Gunsten einer Vielfalt beantwortet, wird das Glück inklusiver und eine artikulierte Konzeption des gelingenden Lebens schließt mehr Ziele ein. Die Vielfalt der Ziele ist sowohl horizontal (quantitativ) als auch vertikal (qualitativ) zu sehen. Das Glück als Zielhorizont des Lebens kann also systematisch einfacher oder komplexer sein.
In diesem Sinne fragt Aristoteles nach dem Glück im Leben als der Frage nach dem aktiven oder dem theoretischen Leben. Und er hat erkannt, dass Exklusivität des Glücks in der epistemischen Favorisierung bestimmter [[exklusive Erlebnistypen]] Erlebnistypen besteht. Für die unterschiedlichen Lebensentwürfe gibt es im Sinne unterschiedlicher Lichtquellen unterschiedliche evaluative Erlebnistypen. Vereinfacht gesagt ist das Erkenntnisvermögen des praktischen Lebens die Lust und das des theoretischen die Vernunft. Viele Philosophen sehen die Vernunft in einem Gegensatz zur Lust. Dafür sprechen Suchtphänomene: Vernunftmotivationen kämpfen gegen begehrliche Motivationen. Die Forderung, dass man sein Leben aber exklusiv auf die Vernunft zu „gründen“ habe, ruft die entsprechende Gegenforderung als exklusive oder inklusive hervor. Steht die Vernunft überhaupt in Gegensatz zur Lust? Müssen wir allein den Geboten der Lust im Leben folgen? Der Streit ist alt und vollkommen ungelöst. (Vgl. Kapitel 12.1
.)
Читать дальше