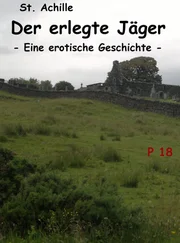Doch als meine Augen die Büsche durchforsteten, starrte mir ein anderes menschliches Augenpaar entgegen. Riesig und wasserblau. Die Elfe!
Ich hatte die engelsgleich schöne Frau mit dem hellen Haar fast vergessen über die aufregenden Erlebnisse der letzten Monate hinweg. Sie musste es sein, nach der Ansphal seit Jahrhunderten suchte.
Zurückhaltend wedelte ich ihr mit einem Farn zu. Sie zuckte zusammen wie ein scheues Reh. Offensichtlich war sie neugierig genug, mich beobachten zu wollen, hatte aber gehofft, ihrerseits ungesehen zu bleiben. Wenn ich zu ihr ginge, auch wenn ich mich ihr langsam näherte, würde sie zweifelsfrei davonstürmen.
Meine Finger strichen gedankenverloren durch das Moos am Ufer, aber ich ließ meinen Blick nicht von ihr.
‚Wäre ich nur auf der anderen Seite des Ufers,‘ dachte ich, und plötzlich war ich es. Auf der anderen Seite, mitten im Gebüsch, nur eine Handbreit von der Frau entfernt. Ein leises Fiepen entrang sich ihrer Kehle. Sie stolperte rückwärts und drohte in die Dornenhecke zu stürzen. Im letzten Moment bekam ich ihr Handgelenk zu fassen und bewahrte sie vor dem Sturz.
„Beruhige dich“, beschwor ich sie. „Ich will dir nichts Böses.“
Gehetzten Blickes sah sie sich um und riss an ihrem Handgelenk, das ich noch immer hielt. Aber solange sie noch flüchten wollte, ließ ich sie nicht los und ich war stärker als sie. Doch da war meine Hand unversehens leer. Von der Frau keine Spur mehr.
Aha! Sie war nicht so unbedarft, wie sie aussah. Die Frau wusste, wie sie sich von einem Ort zum anderen transportierte. Was nun? Mein Instinkt rührte sich. Ich rieb die Handflächen aneinander, als müsse noch ein wenig Feenstaub an ihnen sein und der zarte Duft von Rosen stieg mir in die Nase. ‚Zu ihr‘, dachte ich, ‚ich will zu ihr!‘
Die mich umgebende Luft wurde kühl, das Sonnenlicht verschwand bis auf einen zarten Schimmer, der auf die Steinwände fiel, die mich umgaben. Über mir drückten Felsen und die Arme ausstreckend konnte ich auch nur Steinwände berühren. Ich befand mich in einer der Höhlen, mitten in einem mannshohen Gang. Von der Frau keine Spur. Etwas in mir drängte mich, tiefer in das Gewölbe zu steigen, wo Lichtschimmer zu erahnen waren. Hier und da glänzte Erz in den verschiedenen Gesteinsschichten, doch bisher schien noch niemand den Versuch unternommen zu haben, sie abzubauen.
Nach etwa zweihundert Fuß öffnete sich der Gang zu einem größeren Gewölbe, dessen Anblick mir den Atem raubte. In den Felsen war eine Feuerstelle eingehauen, einem Kamin ähnlich, in dem ein lustiges Feuerchen knisterte, das nirgendwohin abziehen konnte.
Und doch war der Raum klar und nicht von Rauch kontaminiert. Zauberei! Auf dem Boden vor der Feuerstätte lag ein Bärenfell wie dasjenige im Gemach des Fürsten von Ansphal, aber ohne den erschreckenden Kopf mit dem gefletschten Raubtiergebiss. Zur Linken befand sich ein mit Fellen bedecktes Bett, das über eine Leiter bestiegen wurde, ebenso wie jenes, in dem ich in der Burg genächtigt hatte. Nur der Himmel war mit rotem Samt und nicht mit blauem bezogen. Auf der rechten Seite gab es einen massiven Tisch aus dunklem Eichenholz, eine schwere Bank und einen einzigen Stuhl, dessen hochgezogene Lehne mit Stoff bezogen war. Inmitten dieser Pracht stand die Waldelfe und starrte mich entsetzt an.
„Wie konnte Sie mich finden? Wie konnte Sie hier eindringen?“, krächzte sie mit einer hohen Stimme, die sich anhörte, als habe sie sich gerade von einer schweren Halsentzündung erholt.
„Fürchtet Euch nicht“, beschwor ich die Dame und musste ein Schmunzeln unterdrücken, als mir bewusstwurde, dass ich die Worte des Verkündigungsengels benutzt hatte, die er zu Maria sprach, als er ihr die frohe Botschaft verkündete. Meine Botschaft war mehr unglücklicher Natur.
Aufgrund des Fehlens von jeglichem Sonnenlicht, hatte ich die verstrichene Zeit nicht einschätzen können und stand in finsterer Nacht, als ich Agatha verließ. Noch immer umwehte mich ein Gefühl vollkommener Zufriedenheit, endlich jemanden gefunden zu haben, der mich verstehen konnte. Agatha, Fürstin von Ansphal, war wie ich eine Mutter gewesen und auch wenn uns vierhundert Menschenjahre trennten, waren wir doch beide Frauen. Eine rare Spezies in dieser Welt.
Obwohl ich tief in wohligen Gedanken versunken war, befiel mich plötzlich ein Unbehagen. Durch die Kronen der Eichen und Buchen fiel fahles Mondlicht, das mir half, mich gut orientieren zu können. Der Weg würde noch zweimal abknicken, bis ich zur Siedlung der Räuber kommen würde. Vor mir befanden sich drei gut hüfthohe, dornige Sauerdornbüsche, die meine Aufmerksamkeit erregten. Irgendetwas, oder irgendjemand lauerte dahinter.
Ich ballte die Hände zu Fäusten bis sich meine Nägel in die Handflächen gruben. Ein Überfall? Ich verspürte keine Angst. Ich würde mich einfach entmaterialisieren, sobald jemand mich angriff.
Mittlerweile fühlte ich mich nicht mehr schutzlos und nur ein Angreifer wie Vitus würde mich aufhalten können. Leise schlich ich mich auf die Dornen zu.
Im Mondschein erkannte ich eine zusammengekauerte kleine Person auf dem Waldboden. Ein blasses, tränenüberströmtes Gesicht blickte zu mir auf.
„Luis?“, flüsterte ich und ließ zwischen meinen Händen eine Flamme entstehen. Das schwache Licht bestätigte meinen Verdacht. Luis hockte dort vor mir und wimmerte tonlos. Vorsichtig schob ich mich an den Sträuchern vorbei und ließ mich neben dem kleinen Jungen auf den Boden gleiten.
Verschämt rieb er sich die Augen an den schmutzigen Ärmeln seines Kittels trocken. Noch immer schüttelten lautlose Schluchzer seinen mageren Körper.
Vorsichtig strich ich ihm über sein struppiges Haar.
„Was hast du denn?“
„Ich habe Angst“, wisperte er.
„Angst?“
„Vor Irmer. Wenn er Herr der Jagd wird, wird er mich quälen …“
Kalte Schauer liefen mir über den Rücken.
„Was redest du denn da? Warum sollte Irmer …“
Ein schrecklicher Gedanke sauste durch meinen Kopf.
„Ist Veith etwa … ist Veith etwa tot?“
Nachdem ich ihn am Mittag verlassen hatte, war ich sicher gewesen, dass er stabil gewesen war und hatte meinen Gedanken verboten, um den Verletzten zu kreisen. Doch Luis schüttelte den Kopf und zu meiner eigenen Überraschung verspürte ich Erleichterung.
„Nein, noch nicht. Aber er hat so viel geblutet. Das kann doch keiner überleben, oder? Und so lange er schwach ist …“
„Glaubst du, einer der Räuber könnte die Chance nutzen und ihn töten?“
Der Junge nickte. Impulsiv zog ich das Waisenkind in eine feste Umarmung. Ich wollte ihn fragen, ob es eine Rolle spielte, ob Veith oder irgendein anderer der Anführer der Wilden Jagd war, aber Luis war ein kleines Kind, auch wenn er bereits dreißig Jahre oder länger im Ikenwald existierte. Vielleicht lag seine Existenz nicht nur in seiner Schläue und der Eigenschaft, in der Menge zu verschwinden. Vielleicht hielt Veith auch seine schützende Hand über das Kind, wie er es bei mir tat. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich glauben sollte. Veith war kalt, rücksichtlos und gefährlich und doch war Irmer unbestreitbar das größere von zwei Übeln.
„Na komm.“
Ich rappelte mich auf und zog den Jungen hoch, meine Finger noch immer in seinem verfilzten Haar vergraben. Seine Nähe tat mir gut.
„Sehen wir nach unserem Patienten. Wir werden ihn schon daran hindern, seine Pflichten zu vernachlässigen.“
Luis schniefte und murmelte ein getröstetes „Ja“ in meinen Rock. Plötzlich zog er mich an meiner Hand nach unten. „Petto“, flüsterte er so leise, das ich das Wort eher ahnte als hörte. „Er hat Veiths Rücken freigehalten.“ Einen Moment schwieg er. „Ich habe gesehen, wie Irmer Petto gestoßen hat, und dann … war er weg.“
Читать дальше