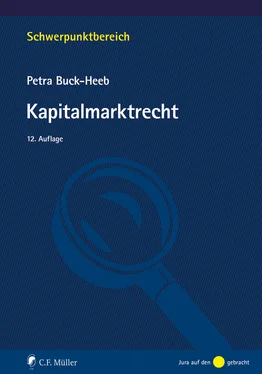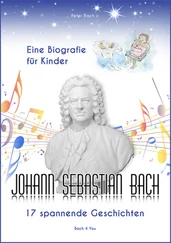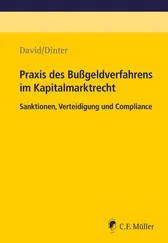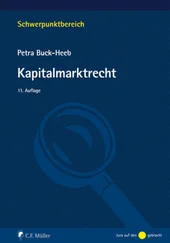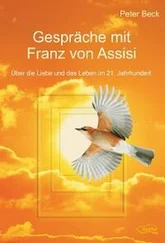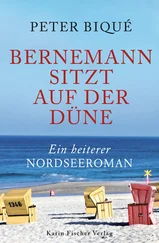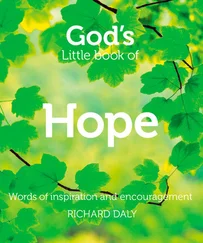201
Ein Hauptversammlungsbeschluss ist für ein reguläres Delisting angesichts der Schaffung des § 39 BörsG (kapitalmarktrechtliche Lösung) nicht (mehr) erforderlich (keine ungeschriebene Hauptversammlungskompetenz)[183]. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass hier keine Strukturentscheidung bzgl der Gesellschaft vorliegt. Ein Beschluss des Vorstands unter Zustimmung des Aufsichtsrats ist grds ausreichend. Auch die Börsenordnungen der einzelnen Börsen können aufgrund dessen keine zusätzlichen gesellschaftsrechtlichen Anforderungen an ein Delisting mehr stellen[184]. Zu beachten ist zudem, dass ein geplantes Delisting eine ad-hoc-veröffentlichungspflichtige Insiderinformation darstellen kann[185]. Bei einem „kalten“ (unechten) Delisting folgt das Zustimmungserfordernis der Hauptversammlung schon aus den jeweiligen gesetzlichen Regelungen (zB §§ 13, 65 UmwG)[186].
202
Gegen die Entscheidung der Börsengeschäftsführung bzgl des Widerrufs der Zulassung (Verwaltungsakt)[187] kann Widerspruch eingelegt und der Verwaltungsrechtswegbeschritten werden. Ob auch der einzelne Anleger die Möglichkeit von Widerspruch und Anfechtungsklage hat, ist umstritten. Der BGH vertrat vor der Gesetzesänderung von 2015 die Ansicht, dass die betroffenen Aktionäre mit Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Widerruf vorgehen können, weil § 39 Abs. 2 BörsG drittschützende Wirkunghabe[188]. Da der Gesetzgeber den Anlegerschutz mit der Schaffung von § 39 Abs. 2 Satz 3 BörsG und § 39 Abs. 3–6 BörsG verstärken wollte, sieht das Schrifttum dies jetzt als eindeutig an[189]. Fraglich ist das jedoch deshalb, weil die Anleger nicht Adressaten der Delisting-Entscheidung der Börsengeschäftsführung sind. § 39 BörsG müsste also als drittschützend angesehen werden, was zumindest angesichts der Gesetzesbegründung zu bezweifeln ist[190].
203
Das Gegenleistungsangebot iS des § 39 Abs. 3 BörsG ist nicht Gegenstand des verwaltungsrechtlichen Rechtsschutzes (§ 39 Abs. 6 BörsG), da die Geschäftsführung nur formal die Voraussetzungen des § 39 Abs. 2 Satz 3 BörsG prüft[191]. Eine Klage gegen die Höhe der Gegenleistung ist aufgrund des Verweises auf § 31 WpÜG zivilrechtlichgeltend zu machen[192]. Die gesetzliche Regelung verweist bzgl des Rechtsschutzes des Anlegers auf das KapMuG (vgl § 1 Abs. 1 Nr. 3 KapMuG)[193].
204
Lösung Fall 1 ( Rn 99):
Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, nach welcher vor Beantragung des Widerrufs der Börsenzulassung (§ 39 Abs. 1, 2 BörsG) die Zustimmung der Hauptversammlung erforderlich ist, existiert nicht. Eine Zustimmung ist auch nicht unter Heranziehung der sog. Holzmüller-Grundsätze[194] notwendig, wonach der Vorstand bei schwerwiegenden Eingriffen in die Rechte und Interessen der Aktionäre ausnahmsweise nach § 119 Abs. 2 AktG eine Entscheidung der Hauptversammlung herbeiführen muss[195]. Durch das Going Private wird nach hM weder die innere Struktur der Gesellschaft verändert noch die mitgliedschaftliche Stellung der Aktionäre geschwächt.
Im Anschluss an die Entscheidung des BVerfG, wonach der teilweise oder vollständige Rückzug von der Börse das Eigentumsrecht des Aktionärs iS des Art. 14 Abs. 1 GG nicht berührt, hat der BGH seine anders lautende Rechtsprechung aufgegeben. Da nunmehr auch aufgrund der 2015 erfolgten Erweiterung der gesetzlichen Regelungen zum Delisting in der Gesetzesbegründung davon ausgegangen wird, dass keine Strukturentscheidung vorliegt, ist V nicht verpflichtet, vor der Beantragung eines Delisting einen Hauptversammlungsbeschluss einzuholen.
Ausgewählte Literatur:
Bauerschmidt, Die Prospektverordnung in der europäischen Kapitalmarktunion, BKR 2019, 324; Bronger/Scherer, Das neue europäische Prospektrecht – (Geplante) Änderungen und ihre Auswirkungen, WM 2017, 460; Buck-Heeb, Das Kleinanlegerschutzgesetz, NJW 2015, 2535; Bußalb/Vogel, Das Kleinanlegerschutzgesetz: Neue Pflichten für Anbieter und Emittenten von Vermögensanlagen, WM 2015, 1733 (Teil I), 1785 (Teil II); Casper, Das Kleinanlegerschutzgesetz – zwischen berechtigtem und übertriebenem Paternalismus, ZBB 2015, 265; Danwerth, Widerrufsjoker 2.0? – Das Last-minute-Widerrufsrecht des § 2d VermAnlG beim Crowdinvesting, WM 2016, 1212; ders., Crowdinvesting – Ist das Kleinanlegerschutzgesetz das junge Ende einer innovativen Finanzierungsform?, ZBB 2016, 20; Dieckmann, Ausweitung des Verbraucherschutzes durch das Kleinanlegerschutzgesetz, WPg 2015, 130; Geyer/Schelm, Das neue Prospektrecht – ein Überblick aus Sicht der Praxis, BB 2019, 1731; Klöhn, Die neue Prospektfreiheit „kleiner“ Wertpapieremissionen unter 8 Mio. €, ZIP 2018, 1713; Kollrus, Kleinanlegerschutzgesetz – Regulierung von Vermögensanlagen des grauen Kapitalmarkts mit erweiterten Aufklärungspflichten, MDR 2015, 1334; Lenz/Heine, Der Nachtrag zum Wertpapierprospekt unter der neuen Prospektverordnung, AG 2019, 451; Lenz/Heine, Incorporation by Reference – Ein neuer Anlauf unter der EU-Prospektverordnung, NZG 2019, 766; Litten, PRIIPs: Anforderungen an Basisinformationsblätter, DB 2016, 1679; Markwardt/Kracke, Auf dem Prüfstand: Das Widerrufsrecht nach § 11 Abs. 2 VermAnlG, BKR 2012, 149; Möllers/Kastl, Das Kleinanlegerschutzgesetz, NZG 2015, 849; Müchler, Die neuen Kurzinformationsblätter – Haftungsrisiken im Rahmen der Anlageberatung, WM 2012, 974; Oulds, Die Nachtragspflicht gemäß § 16 WpPG, WM 2011, 1452; Poelzig, Erleichterungen der Prospektpflicht zur Anpassung an die EU-Prospektverordnung, BKR 2018, 357; Roth, Das neue Kleinanlegerschutzgesetz, GWR 2015, 243; D. Schneider, Das Widerrufsrecht beim Crowdinvesting – § 2d VermAnlG auf dem Prüfstand, WM 2018, 2061; Schrader, Das neue Recht des Prospektnachtrags, WM 2021, 471; Schubert/Schuhmann, Die Kategorie des semiprofessionellen Anlegers nach dem Kapitalanlagegesetzbuch, BKR 2015, 45; Schulz, Die Reform des Europäischen Prospektrechts, WM 2016, 1417; ders., Neue Schwellenwerte für Wertpapierprospekte, NZG 2018, 921; Voß, Das Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung, ZBB 2018, 305; Will/Quarch, Der Kommissionsvorschlag einer EU-Crowdfunding-Verordnung – eine kritische Analyse –, WM 2018, 1481.
205
Der Prospekt stellt regelmäßig die wichtigste Informationsquelle des Anlegers dar und ist Grundlage für dessen Anlageentscheidung[1]. Er dient der Informationdes Anlageinteressenten, der sich ein zutreffendes Bild über den Emittenten und die angebotenen Wertpapiere machen können soll[2]. Dadurch soll das Informationsgefälle zwischen Emittent und Anleger verringert werden. Flankiert wird die Prospektpflicht von der Prospekthaftung[3].
⇒ Definition:
Prospektist ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das Informationen über ein Unternehmen enthält.
⇒ Definition:
Emittentist diejenige Rechtspersönlichkeit, die Wertpapiere begibt oder zu begeben beabsichtigt (Art. 2 lit. h ProspektVO).
206
Ein umfassendes, für alle Anlagen einheitliches Prospektrecht gibt es bislang nicht. Vielmehr findet sich nach wie vor eine Dreiteilung(ProspVO und WpPG, VermAnlG, KAGB). Für Prospekte zur Wertpapierzulassung an einem organisierten Markt (Börse) sowie zum öffentlichen Angebot von Wertpapieren sind die EU-ProspektVO von 2017 (ProspektVO)und ergänzend das Wertpapierprospektgesetz (WpPG)maßgeblich. Die Prospektpflicht für bestimmte, bislang unter den Begriff „Grauer Kapitalmarkt“ gefasste Vertriebsformen außerhalb der Börse ist im Vermögensanlagegesetz (VermAnlG)geregelt. Für Investmentvermögen (v.a. Fonds), gilt die Prospektpflicht des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB).
Читать дальше