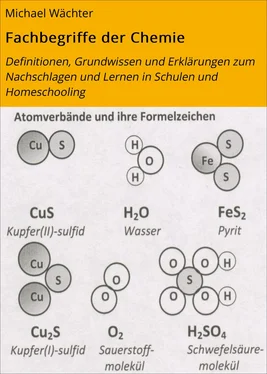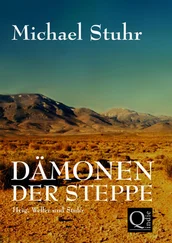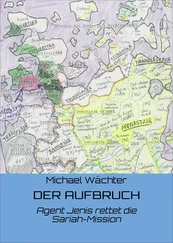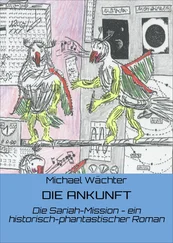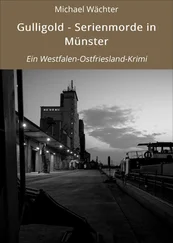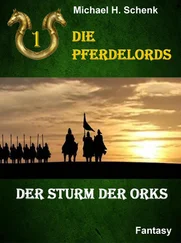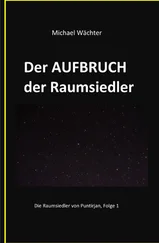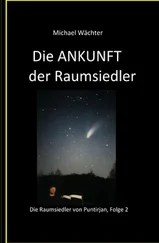4 EnthalpieHist die Wärmeenergiemenge, die von einer bestimmten Stoffmenge eines Reaktionsgemisches bei gleichbleibendem Druck freigesetzt wird.
Hinweise: Die molare Reaktionsenthalpie R H m ist der Quotient aus der Enthalpie(änderung) R H eines bei konstantem Druck reagierenden Systems und der Stoff-/Objektmenge der Formelumsätze. Eine negative molare Reaktionsenthalpie kennzeichnet exotherme Reaktionen: Die Innere Energie U des Systems nimmt ab. Eine positive molare Reaktionsenthalpie kennzeichnet endotherme Reaktionen.
1 Erster Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltungssatz): In einem abgeschlossenen System bleibt die Energie konstant, bei umkehrbaren (reversiblen)ebenso wie bei irreversiblen Prozessen.
1 Die Entropie ist das Maß an Wahrscheinlichkeit, in dem sich ein Reaktionsgemisch befindet, wobei der angestrebte Zustand niedrigster Ordnung (größter Unordnung) der Wahrscheinlichste ist (z.B. größtmögliche Teilchenzahl).
Hinweise: Zur Nutzung von Wärme durch eine Dampfmaschine, ein Kraftwerk oder auch andere Systeme ist nach Nicolas L. Sadi Carnot eine möglichst große Temperaturdifferenz nötig. Das heißt, dass es eine konstante Größe Q /T gibt. Diese Größe S = Q / T wird Entropie genannt. Sie wird in Joule pro Kelvin gemessen, bzw. in Carnot: 1 Ct = 1 J • K-1. Entropie kann als Ordnungszustand eines Systems aufgefasst werden: Die Entropie eines Systems nimmt mit steigender Unordnung zu. Sie hängt zudem mit der statistischen Wahrscheinlichkeit W des Zustandes eines Systems zusammen: S = k • ln W .Die Entropieänderung S chemischer Reaktionen kann aus tabellierten, molaren Standard-Entropien berechnet werden: R S m 0 = S m 0 (Produkte) – S m 0 (Edukte) . Bei positiven S-Werten nimmt die Entropie (die wahrscheinlichere Unordnung) des Systems zu.
Anders ausgedrückt lautet der Erste Hauptsatz (Merksatz 131) aus diesen Gründen oft auch: Energie bleibt stets erhalten, egal wie viel Entropie bei einem Vorgang erzeugt wird (sie kann nicht geschaffen oder vernichtet werden).
1 Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik (Entropiesatz): Entropie kann zwar erzeugt, aber niemals vernichtet werden.
Hinweis: In einem abgeschlossenen System bleiben bei reversiblen Prozessen Exergie – das Energiepotenzial, das in nutzbare Arbeit verwandelt werden kann – und Anergie jeweils konstant. Bei irreversiblen Prozessen hingegen wird die Exergie in Anergie umgewandelt; Anergie kann prinzipiell nicht in Exergie umgewandelt werden). Anders ausgedrückt lautet der Zweite Hauptsatz daher auch: Entropieerzeugung macht einen Vorgang irreversibel, oder: die Gesamtentropie eines Systems und seiner Umgebung kann definitionsgemäß nicht verschwinden, sondern nur gleich bleiben oder zunehmen.
1 Dritter Hauptsatz: Die Entropie eines Idealkristalls am absoluten Nullpunkt T = 0 K ist gleich Null: S0K = 0.
2 Die Gibbs-Energie (Freie Enthalpie) G ergibt sich rechnerisch als Differenz aus der Enthalpie und dem Produkt von deren Temperatur und Entropie: G = H - TS.
Hinweis: Es können stets nur „exergonische“ Reaktionen ablaufen, d.h. solche, bei denen die freie Enthalpie abnimmt.
1 Kinetik ist die Lehre der Bewegungsvorgänge und Mechanismen chemischer Reaktionen.
2 Die Reaktionsgeschwindigkeit vRG bemisst sich in mol Stoffumsatz n pro Zeiteinheit t (also vRG = n/t in mol/s). In Lösungen wird sie definiert als Konzentrationsänderung c eines Stoffes pro Zeitintervall t: vRG = c / t.
3 Die Geschwindigkeitskonstante einer Reaktion ergibt sich als Proportionalitätsfaktor k aus dem Zeitgesetz einer Reaktion. Beispiel: Beieiner Reaktion nach der Gleichung n A + m B AnBm ergibt sie sich zu: vRG = k x c(A)n x c(B)m
1 Die Reaktionsordnung gibt an, in welcher Potenz die Reaktionsgeschwindigkeit von der Konzentration eines Reaktionspartners oder dem Produkt der Konzentrationen mehrerer Stoffe abhängt.
2 Eine (Gleichgewichts-)Reaktion kann durch Druck- und Konzentrationserhöhung der Edukte oder Entfernen der Produkte und Zugabe geeigneter Katalysatoren beschleunigt werden.
Hinweis: Die Reaktionsgeschwindigkeit erhöht sich im Allgemeinen
mit zunehmender Konzentration (oder dem Partialdruck) der Reaktionspartner,
mit zunehmender Temperatur,
durch Anwesenheit von Katalysatoren und
mit zunehmender Oberflächengröße fester Edukte (Verteilungsgrad erhöhen durch Mahlen, Pulverisieren).
Es besteht jedoch keine direkte Beziehung zwischen der Triebkraft einer Reaktion (ihrer freien Enthalpie oder Entropie) und ihrer Geschwindigkeit.
1 Eine Elementarreaktion ist ein Einzelschritt eines Reaktionsmechanismus’ bzw. einer Gesamtreaktion dann, wenn er sich nicht in weitere Teilreaktionen zerlegen lässt.
2 Eine Kettenreaktion liegt vor, wenn im Reaktionsverlauf bei einer Teil- oder Elementarreaktion erneut die Ausgangsprodukte (Radikale) entstehen, so dass es zu einer ständigen Wiederholung der Reaktionen kommt. Verzweigungsreaktionen laufen ab, wenn im Verlaufe der Reaktion durch Verzweigungsreaktionen die Anzahl der Radikale zunimmt, so dass die Reaktionsgeschwindigkeit steigt.
3 Die Arrhenius-Gleichung zeigt den Zusammenhang zwischen dem Geschwindigkeitskoeffizient k (Reaktionsgeschwindigkeitskonstante), der Aktivierungsenergie EA und der Temperatur T: k = A • e(-E(Akt) / R • T) (Arrhenius-Gleichung)bzw.: ln k = ln A – EA / R • 1/T
Grundwissen zuElektrizität und Elektrochemie
1 Die elektrische Stromstärke I entspricht der Ladungsmenge Q, die pro Zeit T fließt: I = Q / T . Sie wird in Ampère (Symbol: A) gemessen: 1 A = 1 C/s.
Hinweise: Die Bewegung elektrischer Ladungen (der Fluss elektrischen Stromes) kommt durch das Bestreben eines Systems zustande, ein elektrisches Potenzial auszugleichen. Die Potenzialdifferenz ist als Spannung U messbar (Einheit: Volt, V). Die elektrische Arbeit W elektr . wird in Watt Sekunde angegeben (1 Ws = 1 J), die elektrische Leistung P= U I in Watt (1 W = 1 J/s).
1 Der Widerstand R wird in der Einheit Ohm (Symbol: ) gemessen: R = U / I (1 Ohm = 1 Volt / Ampère).
Hinweise:
Der Kehrwert zum elektrischen Widerstand ist die elektrische Leitfähigkeit . Er wird als Leitfähigkeit L bezeichnet: 1 / R = L.
Die spezifische Leitfähigkeit = l / ( R A ) in -1 cm -1 eines Materials ist der Kehrwert des spezifischen Widerstandes = R ( A / l ) in cm, den ein Leiter dem Strom entgegensetzt: 1/ = . Als Äquivalentleitfähigkeit bezeichnet man den Quotienten aus der spezifischen Leitfähigkeit und der Konzentration c eines Elektrolyten: = c (Einheit: cm 2 mol -1 -1 ).
1 Als Zellspannung U bezeichnet man die Spannung eines galvanischen Elementes im stromlosen Zustand.
Читать дальше