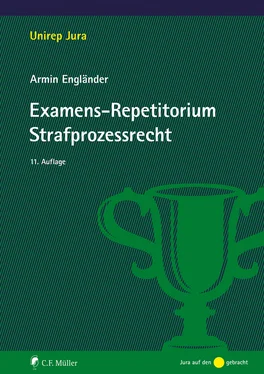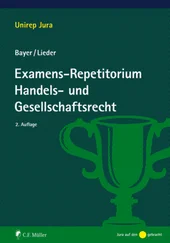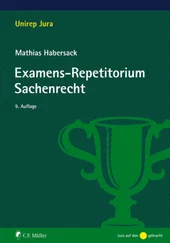27
Einschränkungen:Dieses Zugangsrecht der Öffentlichkeit unterliegt aber bestimmten Schranken, die sich z.T. aus tatsächlichen Umständen, z.T. aber auch aus rechtlichen Gründen ergeben:
| • |
Die Öffentlichkeit kann beschränkt werden, soweit dies zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verfahrensnotwendig ist (z.B. bei begrenztem Platz eine Auswahl nach dem Prioritätsprinzip oder die Ausgabe von Einlasskarten; mittelbare Beschränkung durch Ausweiskontrollen, Durchsuchungen auf Waffen). Unzulässig ist allerdings die Einschränkung ohne triftigen Grund (z.B. die Wahl eines kleineren Sitzungssaals allein, um dadurch eine kleinere Zuhörerzahl zu erreichen). Fall 7:In einem spektakulären Mordprozess gegen den bekannten Schauspieler S herrscht enormes Publikumsinteresse. Der Vorsitzende Richter ordnet aus diesem Grund eine Verlegung des Verhandlungsortes in die Stadthalle an. Lösung:Nicht nur eine willkürliche Beschränkung der Öffentlichkeit, sondern auch eine beliebige Erweiterung der Öffentlichkeit kann unzulässig sein. So ist die Verlegung der Verhandlung in eine große Halle nicht gestattet, sofern hierdurch der Angeklagte zum Schauobjekt gemacht wird und dies einen Verstoß gegen seine Menschenwürde begründet (Meyer-Goßner/Schmitt-Schmitt, § 169 GVG Rn. 5a). |
| • |
Die gesamte Öffentlichkeitkann aus den in §§ 170 ff. GVG genannten Gründen zum Schutz besonderer persönlicher oder öffentlicher Interessenausgeschlossen werden (z.B. zum Schutz der Intimsphäre eines Zeugen). Dem Schutz persönlicher Interessen dient auch § 48 JGG, nach dem die Hauptverhandlung gegen Jugendlichenichtöffentlich ist. |
| • |
Der Ausschluss einzelner Personenwird geregelt in §§ 175 ff. GVG. Darüber hinaus ist er auch aus vorrangigen Verfahrensgrundsätzen zulässig (z.B. bei Zeugen, Arg. aus § 58 Abs. 1 StPO). |
| • |
Schließlich bedeutet Öffentlichkeit nicht Publizität. Das Verbot von Rundfunkaufnahmen(Hörfunk/Fernsehen) sowie von sonstigen Ton- und Filmaufnahmen während der Verhandlung und der Urteilsverkündung zum Zweck der Veröffentlichung, § 169 Abs. 1 S. 2 GVG, verstößt damit nicht gegen den Öffentlichkeitsgrundsatz und ist auch verfassungskonform (BVerfGE 103, 44). Allerdings hat der Gesetzgeber verschiedene Ausnahmeregelungen eingefügt. Mit Genehmigung des Gerichts sind - für die Presse Tonübertragungen (nicht dagegen auch Bildübertragungen) in einen Medienarbeitsraum möglich, § 169 Abs. 1 S. 3 GVG, - bei zeitgeschichtlich herausragenden Verfahren (wie z.B. dem NSU-Prozess) Tonaufnahmen zu wissenschaftlichen und historischen Zwecken zulässig, § 169 Abs. 2 GVG, - in besonderen Fällen Ton- und Filmaufnahmen von Entscheidungsverkündungen des BGH erlaubt, § 169 Abs. 3 GVG. |
Es entscheidet dabei stets das Gericht im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen. Sein Beschluss ist nicht anfechtbar, § 169 Abs. 4 GVG. Mitschriften sind dagegen immer zulässig.
XI. Der Beschleunigungsgrundsatz
28
Der aus Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 6 Abs. 1 EMRK abgeleitete Beschleunigungsgrundsatz besagt, dass der Beschuldigte innerhalb eines angemessenen Zeitrahmensvor Gericht zum Strafvorwurf gehört werden und Klarheit erhalten muss. Die Verletzung dieses Gebotes führt nach h.M. indes nicht zu einem Verfahrenshindernis. Jedoch ist im Falle der Verurteilung in der Urteilsformel auszusprechen, dass zur Entschädigung für die überlange Verfahrensdauer ein bezifferter Teil der verhängten Strafe als vollstrecktgilt (BGHSt 52, 124). Ist eine solche Wiedergutmachung nicht möglich (z.B. beim Freispruch) oder hat der Beschuldigte auch einen Vermögensschaden erlitten, kommt eine Entschädigung nach Maßgabe der §§ 198, 199 GVG in Betracht. Ausnahmsweise kann allerdings in extremen Fällen auf Grund der schwerwiegenden Belastungen des Beschuldigten die Fortsetzung des Verfahrens aus rechtsstaatlichen Gründen nicht mehr hinnehmbar sein, sodass dann das Verfahren einzustellen ist (BGHSt 46, 159).
29
Konzentrationsmaxime:Eine Konkretisierung des Beschleunigungsgrundsatzes für die Hauptverhandlung bildet die Konzentrationsmaxime. Danach soll die Hauptverhandlung möglichst in einem Zug durchgeführt werden; die Möglichkeiten einer Unterbrechungsind entsprechend begrenzt, §§ 228 Abs. 1, 229 StPO. Bei längeren Verzögerungen muss das Verfahren ausgesetztwerden, was eine komplett neue Hauptverhandlung erforderlich macht, §§ 228 Abs. 1 S. 1, 1. Alt, 229 Abs. 4 StPO.
Fall 8:In der Hauptverhandlung gegen den Angeklagten A wird der Zeuge X vernommen. Anschließend unterbricht die Vorsitzende Richterin die Verhandlung für 14 Tage. Im nächsten Termin werden lediglich die Einträge des A in das Bundeszentralregister verlesen und die Verhandlung dann für weitere 14 Tage bis zur Vernehmung des Zeugen Y unterbrochen.
Lösung:Zur Fristwahrung i. S. d. § 229 Abs. 1 StPO kommen nur solche Termine in Betracht, die das Verfahren sachlich fördern. Bloße Schiebetermine– wie die ausschließliche Verlesung von Briefen oder Registerauszügen – bleiben dagegen unberücksichtigt und setzen keine neue Frist in Gang (BGH NJW 1996, 3019). Das bedeutet, dass das Verfahren hier erst nach vier Wochen fortgesetzt wurde. Damit muss das Verfahren nach § 229 Abs. 4 S. 1 StPO von neuem begonnen werden.
XII. Das Prinzip „nemo tenetur se ipsum accusare“
30
Der Beschuldigte darf nicht gezwungenwerden, an seiner eigenen Überführung aktiv mitzuwirken. Dieser aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG abgeleitete Grundsatz wird in der StPO insb. durch ein umfassendes Schweigerecht des Beschuldigten im Ermittlungs- und Hauptverfahren abgesichert, §§ 136 Abs. 1 S. 2, 243 Abs. 5 S. 1 StPO. Allerdings muss er Angaben zur Person machen und ggf. körperliche Eingriffe dulden, § 81a StPO. Umstritten ist, ob der nemo-tenetur-Grundsatz den Beschuldigten auch vor täuschungsbedingten Selbstbelastungenschützen soll (näher dazu Fälle 51a–51e).
XIII. Der Grundsatz des fairen Verfahrens (fair trial)
31
In zunehmendem Maße greifen Rspr. und Lit. zur Begründung von Rechten und Pflichten der am Strafverfahren Beteiligten direkt auf den aus der Verfassung abgeleiteten (Art. 1 Abs. 1, 20 Abs. 3, 101 Abs. 1 S. 2, 103 Abs. 1 GG) Grundsatz des fairen Verfahrens zurück. Genauer Inhalt und Reichweite dieser Prozessmaxime sind allerdings noch nicht abschließend geklärt (vgl. näher LR-Kühne, Einl Abschn. I Rn. 103 ff.). Jedenfalls kann man aber in ihr die Direktive sehen, dass in Konfliktsituationen die Interessen des Beschuldigten nicht einfach zu Gunsten der Effizienz der Strafrechtspflege geopfert werden dürfen (Volk/Engländer, § 18 Rn. 9). Besondere Bedeutung kommt dem fair-trial-Prinzip in der Rspr. des EGMR zu, der die in Art. 6 Abs. 1 u. 3 EMRK aufgeführten Justizgrundrechte als Ausprägungen eines übergreifenden Rechts auf ein faires Verfahren versteht. Dabei kommt es nach dem EGMR immer auf die Fairness des Verfahrens in seiner Gesamtheitan (Prinzip der Gesamtabwägung); ein Verstoß gegen einzelne Verfahrensgarantien begründet daher keine Verletzung des fair trial-Prinzips, wenn das Verfahren insgesamt noch fair war (näher dazu Esser, Europäisches und Internationales Strafrecht, 2. Aufl. 2018, § 9 Rn. 218 ff.).
§ 4 Die Gerichtszuständigkeit und -organisation
I. Die sachliche Zuständigkeit in der ersten Instanz
Читать дальше