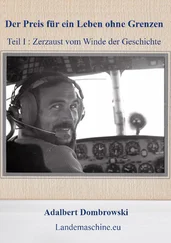Ankunft ohne Wiederkehr - Teil 1
Ankunft ohne Wiederkehr - Teil 1
Von Vicky Lines
Der letzte Tag
Samantha Willer, Berlin, September 2015, Donnerstag
Meine Augenlider öffneten sich nur schwer. Ein Glück, dass ich auf dem Rücken lag und die Sonnenstrahlen es mir leichter machten, meine Augen zu öffnen. Die Zimmerdecke schwebte da über mir, schien mir viel zu nah und trotz alledem unerreichbar zu sein. Sekunde um Sekunde entfernte sie sich. Heute Morgen brummte oder gar schrie wenigstens nichts in meinem Kopf. Meine lebhaften Träume der letzten Nächte hallten immer noch eine Weile, wie ein Bergecho, nach. Ziemlich wirre Episoden, die eigentlich in einen Film oder ein Buch gehörten. Trotzdem war dieser Morgen nicht wie sonst, weil ich heute Abend nach London flog. Vor einem halben Jahr hatte ich mich entschieden, diese Stadt besuchen zu wollen. Zahlreiche Bücher und Filme pflanzten etwas namens Neugier in mein Köpfchen. Meine Familie, wie ich sie lapidar nannte, überredete mich, nachdem sie mich immer öfter mit Büchern über London erwischt hatten, meinen Urlaub in dieser Stadt zu verleben. Bis hierhin dachte ich immer, ich liebte Berlin zu sehr, um meine Heimatstadt zu verlassen und mich aus meinem Schneckenhaus zu bewegen. Den ganzen Stress, den die Arbeit mit sich brachte, kompensierte ich in den letzten sechs Jahren mit Heimurlaub, Voyage de Balkonie. Dieser neue Job, dem ich seit mittlerweile drei Jahren nachging, brachte mir zwei neue Themen in mein bis dahin sehr tristes und ödes Dasein: einen furchtbar egoistischen und uneinsichtigen Chef, aber auch zwei liebe, ebenfalls leidende Kolleginnen. Es war schon seltsam und auch bedenklich, dass in der Informatik um ihn herum nur weibliche Angestellte diesem Chef zuarbeiteten. Immer wieder redeten wir drei in unserer Mittagspause, die wir überwiegend außerhalb der Firma verbrachten, über unsere Situation. Entlohnt wurden wir schon recht ordentlich, doch das Pensum wurde immer wieder durch seltsame Einfälle und Anfragen arg bedrängt. Innerlich brachte mir das immer wieder ein wenig Motivation, die ich auch heute dringend benötigte, um nicht vollkommen diesen letzten Tag zu verreißen. Waren wir drei gut drauf, schlussfolgerten wir bei unserer Bewältigung der Missstände am Ende, es ginge um fehlende geschlechtsbezogene soziale Interaktion bei unserer Arbeit. Andererseits schoben wir es auf sadistischen Sexismus und zu viel Testosteron bei den ganzen Schlipsträgern. Egal, wie wir es auch drehten, dieser Chef hatte eine gehörige Macke, nur kannten wir den Grund seines seltsamen Gebarens nicht. Allenthalben gab er mit uns auch vor seinen Freunden an. Die Firma lief gut, es gab reichlich zu tun, denn die Vorgänger, ja das waren „leider“ Männer, hatten hier und da einen kleinen Haufen Chaos hinterlassen. Meine Kollegin Maren, die mit mir die Verwaltung all der Daten und Rechentechnik vor ungefähr drei Jahren übernommen hatte, hielt immer zu mir, wann auch immer unser Chef wieder irgendwo einen Haken suchte, an dem er uns aufhängen wollte. Dafür dankte ich ihr oft, indem ich das ebenfalls für sie tat. Rita, die Dritte im Bunde, beschäftigte sich mit Steuern und Buchhaltung der hiesigen Dependance. Ihr Gespür für die richtigen finanziellen Entscheidungen brachte unsere Firma weg vom Rand des finanziellen Chaos. Alles in allem stand meinem Job eine Drei zu, wenn ich Zensuren vergeben würde. Also ging es mir eigentlich mit ein bisschen Murren nicht wirklich schlecht. Ich schluckte – genug der versuchten Motivation, heute zur Arbeit zu fahren. Dann schwante mir der eigentliche Unbill des Tages. Kurz vor dem Abflug berief meine Mutter noch ein Familientreffen ein. Huch? Meine Arme bewegten sich, ich schien wirklich wach zu sein. Da! Die Beine auch. Klasse. So richtig wach also.
Kaum dachte ich über den Tagesverlauf und meine Stolperfallen nach, hatte sich mein Körper, wie beinahe jeden Tag, in meiner Wohnung in mein weiß gefliestes Bad bewegt. Also heraus aus dem gemütlichen Schlafzimmer, über den ungemütlichen Flur, ins helle Bad. Die tiefstehende Herbstsonne brüllte mich gnadenlos an. Schnell unter die Dusche hüpfen und dann die üblichen Versuche, mein Alter hinter mehr oder minder geschicktem Makeup zu verbergen, zeugten von eingefleischter Alltagsroutine. Wieder so ein komisches Wort, Alltagsroutine. Falsch, Routine ist Alltag und umgekehrt. Kopf geschüttelt, damit ich noch ein wenig mehr meiner Selbst Herrin wurde. Mit meinen zweiundvierzig Jahren beklagte ich noch nicht so sehr viele altersbedingte Kollateralschäden in meinem Gesicht. Deshalb gelang es mir ohne künstlerisches Talent, mich immer wieder irgendwie genießbar herzurichten. Mir kam es so vor, als stünde seit zehn Jahren die Zeit still. Vielleicht war die Batterie vom Spiegel leer. Allerdings wusste ich, dass die beiden vorherigen Jobs mich richtig gefordert und auch innerlich beinahe aufgefressen hatten. Seitdem gewöhnte ich mir einen Arbeitsstil im Schatten an. Oder ich wollte einfach keine öffentlichen Rechenschaften mehr ablegen, weshalb ich wann, was und womit erledigt habe. Doch heute fragte ich mich, warum ich mich eigentlich jeden Tag schminkte. In den letzten drei Jahren war es sehr still in meinem Privatleben geworden. Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig still. In mir löste sich die Wehmut und kroch – besser – rannte durch meine Brust, was mit einem kleinen Stich honoriert wurde. Direkt in meinem Kopf gebar es und kam als Seufzer auf die Welt. Sie hatte eigentlich keinen Sinn, meine morgendliche Schminkübung. Keinen rationalen zumindest, wahrscheinlich aber einen tieferen emotionalen Grund. Eben noch wollte ich mich nicht aufgeben und schon waren wieder die leicht depressiven Tendenzen spürbar. Somit folgte noch ein Seufzer. Der wiederum kam nur vom Kopf und fand ziemlich schnell den Weg nach draußen. Einer ist keiner. Oder nimm zwei. Von Zeit zu Zeit liefen mir optisch ansprechende Menschen mit dem gewissen Etwas zwischen den Beinen über den Weg, doch sobald ich auch nur länger als dreißig Sekunden hinsah, kam in mir die Alarmsirene, dass ich gar keinen Grund hätte, mich opfern zu müssen. Meine letzten Erfahrungen schüttelten mich dann immer durch. Neulich mit einem Schüttelanfall, als hätte ich reale Malaria-Fieberschübe. Welchen Grund es dafür gab? Keine Ahnung. Alles verdrängt. Vermutlich stimmte es, was mir meine Schwester Patrizia immer mal wieder zu bedenken gab. Es drehte sich meistens um nicht bewältigte Jugendtraumata und das gemeinsame Geheimnis. Nun gut, nach der kleinen, aber geglückten Schminkübung war doch mal ein erster Pluspunkt heute für mich erstritten worden. Nun zog ich an diesem Donnerstag bequeme Kleidung für die Reise an. Frühstück? Nein! Danke. Schon gar nicht alleine. Also schnappte ich mir elegant meinen kleinen Rollkoffer. Doch bevor ich loslief, prüfte ich noch einmal alle notwendigen Utensilien. Schminktasche, samt Miniapotheke, Dokumente, Fotoapparat, Handy, Tablet mit Zubehör und all das, was eine Frau ohne Ambitionen noch so herumschleppte, wenn sie die Wohnung für zehn Tage hinter sich ließ. Gestern und vorgestern arbeitete ich meine Reiseliste ab und erarbeitete mir somit für diesen Morgen des Monats September die notwendige Ruhe für diesen unerquicklich erscheinenden Donnerstag. Auch wenn ich Religionen ziemlich belastend fand, Halleluja. Es begann zu regnen. Falsch, passender musste es lauten, es pladderte gegen die Fensterscheibe, die ich gleich nach meiner Wiederkehr putzen wollte. Gute Einstimmung, emotional und geografisch, fand ich. Londons nachgesagtes Lieblingswetter entsprach so gut meinem inneren Gefühlschaos, dass es mich seltsamerweise beruhigte. Sieh da, der Welt geht es ähnlich wie mir. Ich musste einfach über meine Erkenntnis lächeln.
Читать дальше