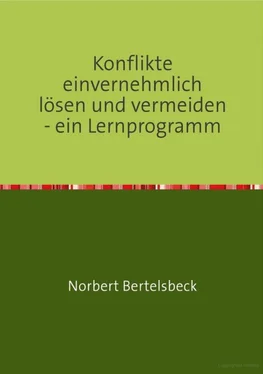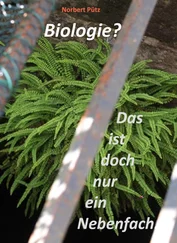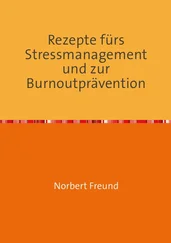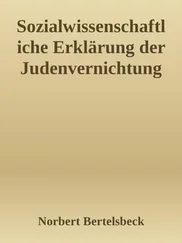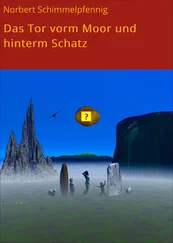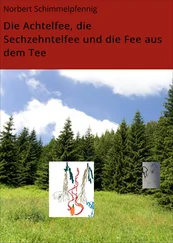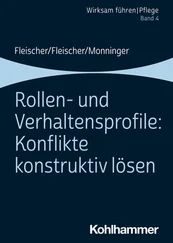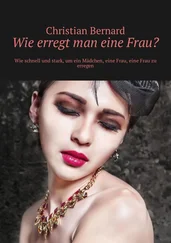- Waren in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts Männer berufstätig und Frauen primär im Haushalt tätig, so hat sich diese Situation grundlegend geändert: Auch Frauen sind heute zum größten Teil berufstätig. Einhergehend mit einer veränderten Frauenrolle muss auch der Mann sein Rollenverständnis überprüfen. Männer und Frauen müssen heute mehr als früher aushandeln, was eigentlich ihre Aufgaben sind.
So können Eheleute dann unterschiedlicher Auffassung darüber sein, welchen Part Mann und Frau bei der Kindererziehung übernehmen und mit welchen Inhalten überhaupt erzogen werden soll, wie die Aufteilung der Hausarbeit zwischen Ehepartnern erfolgt, wer Einkäufe oder Finanzangelegenheiten tätigt, die Gartenarbeit übernimmt und Freunde einlädt. Desgleichen können Meinungsverschiedenheiten bestehen, wie die Freizeit und der Urlaub zu gestalten sind, welche Anschaffungen erfolgen sollen und in welcher Qualität, wie häufig Eltern, sonstige Verwandte und Freunde zu besuchen sind etc.
- In der Familie können Eltern und Kinder unterschiedliche Meinungen über die Akzeptanz von Lärm, Ausgeh-, Schlafenszeiten, den Freundeskreis, der Beteiligung von Kindern an der Hausarbeit etc. haben. Derartige Konflikte sind von Eltern früher, d. h. noch in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts, autoritär entschieden worden, während heute eher ein gesellschaftliches Klima vorherrscht, auch die Kinder in derartige Konfliktlösungen einzubeziehen.
- Wenn auch im Beruf Konflikte vermieden werden durch die Geltung bestimmter arbeitsrechtlicher Normen, können nichtsdestotrotz sowohl zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern als auch zwischen Arbeitskollegen Konflikte unterschiedlichster Art bestehen.
So sind beispielsweise Arbeitskollegen unterschiedlicher Meinung hinsichtlich des zeitlichen Öffnens von Fenstern, des Ausmaßes des privaten Telefonierens, der Pausenzeiten, der Art und Weise der Kooperation etc. Und auch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern können Konflikte hinsichtlich der Beförderung, der Urlaubszeit, der Arbeitsqualität, der Mehrarbeit, Arbeitsüberlastung, Weiterbildung, frühzeitigen Unterrichtung bei Krankheit etc. vorliegen.
- In der Schule können Schüler im Unterricht reden und laut lachen, umherlaufen oder sonstigen Lärm machen, andere Schüler beleidigen oder schlagen, Lehrer beleidigen oder ihnen nicht antworten, Gegenstände zerstören, verspätet zum Unterricht erscheinen oder zu früh die Schule verlassen, sich am Unterricht nicht beteiligen, Hausaufgaben nicht erledigen etc.
Schüler ihrerseits können sich vom Lehrer bei der Zensurengebung oder der Bewertung sonstigen Schülerverhaltens ungerecht behandelt fühlen, von ihm beleidigt werden, sich im Unterricht langweilen etc.
Konnten in den fünfziger und sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts Lehrer auf unannehmbares Schülerverhalten noch mit körperlicher Gewalt reagieren, ist das heute nicht mehr möglich, und Eltern achten heutzutage mehr als früher darauf, dass ihren Kindern in der Auseinandersetzung mit Lehrern kein Unrecht geschieht.
(4) Das Lösen und Vermeiden von Konflikten
Im Alltagsleben wird das Bestehen von Konflikten zumeist negativ bewertet, als Folge von negativen Erfahrungen mit Konfliktlösungen. Der Versuch, Konflikte zu lösen, endet häufig mit psychischen Verletzungen, Niederlagen und verschlechterten Beziehungen als Folge des destruktiven Umgangs mit Konflikten.
So erleben Kinder häufig zu Hause, dass Konflikte mit den Eltern von diesen durch den Einsatz von Bestrafung gelöst werden. Solche Erfahrungen sind mit negativen Gefühlen (Wut, Ärger, Trauer, Enttäuschung, mangelnder Selbstwert etc.) verbunden. Umgekehrt können jedoch auch Eltern im Konflikt den Kürzeren ziehen und Kinder gewähren lassen, „um des lieben Friedens willen“. Dieses ist dann ebenfalls verbunden mit negativen Gefühlen den Kindern gegenüber.
Wird das Bestehen von Konflikten negativ bewertet, so scheut man sich auch, Konflikte offen auszutragen. Zu beachten ist jedoch, dass das Aussitzen von Konflikten zu einer Eskalation beitragen kann: Irgendwann platzt einem der Kragen, und es erfolgen dann (emotionale) Reaktionen, die dem aktuellen Konfliktanlass nicht angemessen sind. Wenn hingegen eine Auseinandersetzung zwischen Personen erfolgt, dann geschieht dies oft mit dem Ziel, sich im Konflikt durchzusetzen.
Liegen im Allgemeinen Erfahrungen mit der Lösung von Konflikten im Sinne von Gewinnen und Verlieren vor, sollen in dieser Arbeit Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sich Konflikte zur Zufriedenheit aller daran Beteiligten lösen lassen. Damit soll dann zugleich auch eine positive Einstellung zur Konfliktlösung gefördert werden.
Ist das Lösen von Konflikten ein Thema, so ist deren Vermeidung ein weiteres. Gemäß dem Motto „Vorbeugen ist besser als heilen“ hat das Vermeiden von Konflikten dabei Priorität und wird deshalb hier auch ausführlich behandelt.
(5) Theoretische Grundlagen
Das hier dargestellte Modell der Konfliktlösung und -vermeidung wird als partnerschaftlich bezeichnet. Es grenzt sich ab von Versuchen, Konflikte zu lösen oder zu vermeiden durch Einsatz von Macht, indem in einer Zweierbeziehung die andere Person mittels Belohnung oder Bestrafung zu einem bestimmten Verhalten veranlasst werden soll. Hierauf ist weiter oben schon eingegangen worden. Stattdessen sollen Personen freiwillig zu Lösungen gelangen.
Personen können darüber hinaus auch mittels eines strategischen Verhaltens, d. h. eines solchen, das die wahren Absichten verdeckt, versuchen, zu einer für sie günstigen Konfliktlösung zu gelangen. Stattdessen sollen Konflikte in einem offenen Gespräch gelöst werden.
Wird bei der Lösung von Konflikten und deren Vermeidung auf Freiwilligkeit und Offenheit im Gespräch Bezug genommen, so sind dieses Merkmale, die dem partnerschaftlichen Beziehungsmodell von Thomas Gordon zugrunde liegen.
Thomas Gordon wurde 1918 in einer amerikanischen Kleinstadt mit dem Namen der Weltstadt Paris geboren und verstarb im Jahr 2002. Er studierte zunächst Medizin und anschließend Psychologie, u. a. bei Carl Rogers, dem Vater der Gesprächspschotherapie, zu dem er auch viele Jahre eine freundschaftliche Beziehung unterhielt. Das Studium wurde zwischenzeitlich unterbrochen durch Gordons Einberufung in die Armee während des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Studium arbeitete er zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität. Danach wurde er Unternehmensberater, zunächst in abhängiger Stellung, dann als Selbstständiger. Neben dieser Tätigkeit war Gordon später auch als Therapeut tätig. Unzufrieden mit seiner therapeutischen Tätigkeit wandte er sich seit 1962 vornehmlich dem Thema zu, wie sich Beziehungen zwischen Personen verbessern lassen. Gordon hatte sich schon in früheren Jahren mit diesem Thema beschäftigt und zwar in Bezug auf demokratisches Führungsverhalten in Organisationen. Später wurde das Modell partnerschaftlicher Beziehungen auch auf andere Personengruppen übertragen (vgl. Breuer, Karlpeter Hrsg.: Das Gordon-Modell).
Das Beziehungsmodell wird dabei in verschiedenen Veröffentlichungen in deutscher Sprache dargestellt: Neben Publikationen, die das partnerschaftliche Beziehungsmodell in allgemeiner Weise darstellen, gibt es auch solche, die das Modell auf bestimmte Personengruppen anwenden.
Das Gordonsche Beziehungskonzept ist nun Grundlage dieses Buches. Dabei wird auf Veröffentlichungen Bezug genommen, die das partnerschaftliche Beziehungsmodell in allgemeiner Weise zum Gegenstand haben, das heißt sich nicht mit bestimmten Personengruppen befassen.
Welche Inhalte sind nun Gegenstand des Gordon-Modells? In allgemeiner Weise lässt sich sagen, dass sich Gordon mit der Lösung verschiedenartiger Probleme beschäftigt:
Читать дальше