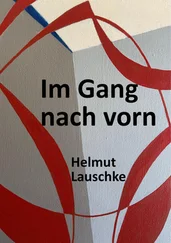Aber zumindest nachts fühlte ich mich wohl, und so war diese Zeit zwischen vierzehn und siebzehn eine vergleichsweise glückliche. Jeden Abend schlich ich mich davon und machte Party. Ich lernte, in der Schule mit offenen Augen zu dösen. Und ich spürte die seltsame Verpflichtung, mit jedem Mann, der sich um mich bemühte, ins Bett zu gehen. Und das ohne jeden Lustgewinn für mich. Es schien, als ob meine Daseinsberechtigung von meiner sexuellen Verfügbarkeit abhinge, aber ich kam damals gar nicht auf den Gedanken, diesen seltsamen Zwang zu hinterfragen. Zu meinem Glück waren die jungen Männer um mich herum meist viel zu wohlerzogen, um sich mit mir einzulassen.
Dann lernte ich meinen ersten festen Freund kennen. Er ertrug meine Eskapaden und Lieblosigkeiten und stärkte mir den Rücken gegen meine Eltern. Nachdem meine Schwester mein Sexabenteuer im elterlichen Ehebett gepetzt hatte, behandelten mich meine Eltern wie eine Aussätzige. Mein Vater sprach drei Jahre lang kein einziges Wort mit mir. Meine Eltern hatten meine Verzweiflung und Verrohung geflissentlich übersehen und nahmen sich jetzt das Recht, mich zu verachten? Ich hasste meine Mutter genauso tief, wie ich sie früher geliebt hatte. Und die ganze bürgerliche Bagage, mit der sich meine Eltern umgaben, hasste ich auch, diese Horde klüngelnder Hyänen, die jeden zerrissen, der eine Blöße zeigte. Ich klaute meine Kleider, trank die herrenlosen Biere an der Theke und klaubte Kippen vom Trottoir, damit ich meine Eltern nicht um Geld bitten musste.
Nach zwei Jahren langweilte ich mich mit meinem Freund und machte Schluss. Meine Schulfreundinnen verließen die Schule, begannen Ausbildungen und führten ein braves Leben. Plötzlich war ich wieder allein und versank erneut in eine tiefe Depression.
Ich versuchte, mich irgendwie durchzuhangeln, fand andere Mädchen zum Ausgehen, Männer, mit denen ich schlief oder eine Zeit lang zusammen war. Aber meine innere Welt verödete immer mehr, ich wurde hart und skrupellos, und mein Anspruch, ein Gutmensch zu sein, erstickte in dieser trostlosen Leere.
Durch geschickte Wahl meiner Leistungsfächer blieb ich mit einem Minimum an Anstrengung und einem Maximum an Fehlstunden auf der Zielgeraden zum Abitur. Nur: Was sollte danach kommen? In der Schule hatte ich meine Vermeidungsstrategien entwickelt, aber in neuen Lebensumständen wimmelte es von unkontrollierbaren Situationen. Mit meiner Sozialphobie war ich einfach nicht lebenstauglich. Meine Scham, diese Schwäche zuzugeben, und meine Angst vor Menschen ging so tief, dass ich mich nicht einmal einem Therapeuten anvertraut hätte. Aber das stand gar nicht zur Diskussion – ich hätte mich meinen Eltern niemals offenbart und um eine Therapie gebeten.
Die Zukunft war gleichermaßen angsteinflößend wie öde. Ich hatte weder Ehrgeiz noch Interessen, Karriere war mir völlig egal. Partnerschaft und Familie? Welcher Mann sollte mich lieben, wenn er erst mal erkannte, was für ein erbärmliches Geschöpf sich hinter der glänzenden Fassade verbarg? Und das würde ein Partner erkennen in einem Zusammenleben, das aus mehr als betrunkenem Sex und Clubbesuchen bestand.
Insofern wurde das Abitur zu keinem Freudenfest für mich. Ich immatrikulierte mich in M., wo schon meine Schwester studierte, für Philosophie. Mit einem Scheinstudium konnte ich erst mal Zeit schinden, hatte allerdings nicht vor, auch nur eine einzige Vorlesung zu besuchen. Ein Studium war ausgeschlossen – ich hätte vor anderen sprechen, Arbeitsgruppen besuchen und Referate halten müssen. Von meinen Eltern akzeptierte ich nur ein Minimum an Geld.
Bald fand ich ein winziges Zimmer in der Innenstadt von M. und über die Studenten-Job-Vermittlung gutbezahlte Jobs, die mit meiner Phobie vereinbar waren. Ich putzte bei einem gestörten Psychologen, stand am Band einer Fabrik und verteilte schließlich als Hostess für ein neu eröffnetes Kaufhaus Rosen an die Passanten.
Und hier ereilte mich mein Schicksal.
***
2
Er fiel mir auf im Strom der Menge: Braungebrannt, kahlrasiert und exotisch mit entrücktem Blick wie ein Mönch aus fernen Landen, lief er leichtfüßig zwischen den Menschen und gehörte doch nicht zu ihnen. Es ging eine intensive, außergewöhnliche Ausstrahlung von ihm aus. Hochgewachsen und sehr schlank war er, und doch muskulös und voller Vitalität. Seine Kleidung und sein indischer Schmuck waren gleichzeitig alternativ und exklusiv.
Wie ein Sonnenstrahl durchbrach seine abgehobene Geistigkeit die dicke Hornhaut um mein Herz und öffnete eine Tür zu einer mir bis dahin unbekannten Ebene. Unwillkürlich musste ich lächeln. Doch sobald er mich bemerkte, verwandelte sich sein Blick auf erschreckende Weise in den eines versierten Jägers und zielstrebig kam er auf mich zu. Da war nichts mehr von seiner vorherigen Reinheit. Die Tür in mir fiel so schnell zu, wie sie sich geöffnet hatte, und ab da erschien er mir nur noch wie ein gewöhnlicher Mann mit gewöhnlichen Absichten.
Ich hatte seinem forschen Auftreten nichts entgegenzusetzen. Er war ein anderes Kaliber als die jungen Männer, mit denen ich bislang zu tun gehabt hatte. Mühelos überrannte er meinen Widerstand und zwängte mir eine Verabredung auf, die ich nicht wollte. So sympathisch er mir beim ersten Blick gewesen war, so abstoßend empfand ich jetzt seine durchtrainierte Anmache-Tour. Es war mein letzter Tag als Rosen-Verteilerin, und ich machte früher Feierabend, um ihm zu entkommen. Auf Seitenstraßen lief ich nach Hause und ihm geradewegs in die Arme. Ertappt ließ ich mich in die nächste Kneipe mitziehen.
Ioannis erzählte mir, dass er grade von einer langen, spirituell motivierten Reise nach Indien zurückgekehrt sei, die ihn sehr geläutert habe. Aber ich spürte bei ihm nur den Wunsch, mich flachzulegen. Und nach ein paar Bieren war ich bereit zu tun, was ich schon so oft getan hatte.
Doch Ioannis wollte mehr als einen One-Night-Stand. Und ich blieb, weil es in meinem Leben keinen Grund gab, zu gehen. Schon bald begann er, mich ins Vertrauen zu ziehen und mir aus seinem Leben zu erzählen.
Ioannis‘ Mutter hatte seinen Vater an der Uni von Thessaloniki kennengelernt. Sie studierte Jura, was in den 40iger Jahren für eine griechische Frau sehr ungewöhnlich war, zumal sie aus einfachen Verhältnissen stammte. Ioannis‘ Vater verliebte sich in die puppenhaft schöne, kleine Frau und sie heiratete ihn, auch wenn das das Ende ihres Studiums bedeutete. Sie war jetzt Hausfrau und bald auch werdende Mutter. Nach einer schweren Schwangerschaft und noch schwereren Geburt kam Ioannis halbtot zur Welt und blieb lange Zeit kränklich. Ioannis' Vater liebte seinen Erstgeborenen und stellte ihn über alles. Bald bekam Ioannis einen kleinen Bruder, auf den er sehr eifersüchtig war. Die Mutter schloss den Bruder ins Herz, vielleicht grade, weil der Vater Ioannis so vergötterte.
Aber mit seiner Ehefrau bekam der Vater zusehends Probleme. Sein männliches Ego litt unter ihrem Durchsetzungswillen und scharfen Verstand. Als Ioannis sechs Jahre alt war, nahm sich der Vater eine Geliebte. Aber statt, wie es damals von einer griechischen Ehefrau erwartet wurde, zu Kreuze zu kriechen und den Vater zu beschwören, bei ihr zu bleiben, machte sich ihr verletzter Stolz in dramatischen Szenen Luft. Bald prügelte der Vater seine Frau blutig und diese gab die Prügel an Ioannis, Papas Liebling, weiter.
Der Vater ließ die Familie schließlich ohne Geld hinter sich. Damit war Ioannis' Mutter in einer verzweifelten Lage, denn es gab keine vermögenden Verwandten und Arbeit zu finden war schwer. Sie brachte den kleinen Bruder zu ihrer Mutter, doch Ioannis landete bei der Schwiegermutter, die schizophren und unberechenbar war. Oft sperrte sie Ioannis in der Wohnung ein und kam erst Tage später zurück. Dann wieder gab sie ihm nichts zu essen und zwang ihn zu rauchen. Zudem wurde Ioannis regelmäßig von einem männlichen Verwandten sexuell missbraucht. Ioannis hasste seine Mutter. In seinen Augen hatte sie ihn für ihren Stolz geopfert. Und er war tief enttäuscht von seinem Vater, der ihn plötzlich von sehr weit oben hatte fallen lassen.
Читать дальше