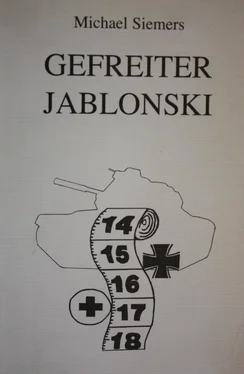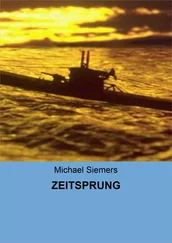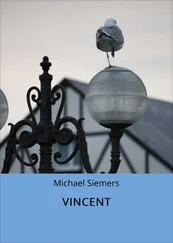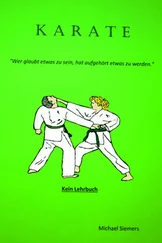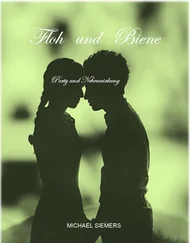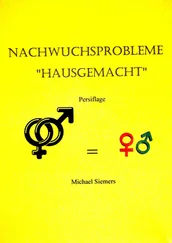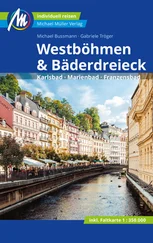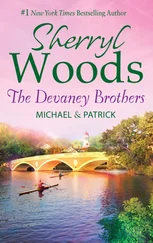Gemeinsam machten sie sich auf den Weg in die Stadt, um die letzten Stunden
dieses Sonntages zu genießen.
Am Montag gegen 6 Uhr 30 erreichte Jablonski den kleinen Rahlstedter Bahnhof.
Da es am Vorabend sehr spät geworden war, zog er es vor, einfach zu Hause zu
schlafen, da er es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht geschafft hätte.
Seine Freundin brauchte ihren Wagen selbst, um an diesen Tag nach Marburg zu
kommen.
Der Himmel war grau mit Wolken behangen und es sah nach Regen aus. Bis auf
wenige Leute, die ihm entgegen kamen, um zum Bahnhof zu eilen, wirkte die
Schweriner Straße recht verlassen. Am Straßenrand türmten sich rausgestellte
Möbel, Kartons und allerlei Müll aus den Kellern der Anwohner und den
Geschäften. Teils sorgfältig aufgebaut, teils aber auch völlig durchwühlt von
sogenannten Sperrmüllsammler sah es recht unordentlich aus und passte nicht so
recht in das Straßenbild der ansonsten gepflegten Ladenreihe. Papier und
Styroporstücke wehten am Straßenrand entlang und fingen sich in den Büschen
der Begrünungsflächen.
Die Hände tief in den Taschen vergraben ging Jablonski in Richtung der
Stapelfelder Straße. Sein Blick fiel plötzlich auf einen gynäkologischen
Untersuchungsstuhl, der von dem, in der Schweriner Straße ansässigen Frauenarzt
zum Sperrmüll gestellt wurde. Ausgerechnet an einer Bushaltestelle musste er
das Ding hinstellen. Etwas pikiert sahen die dort wartenden Frauen demonstrativ
in eine andere Richtung. Jedem vorbei eilenden Mann huschte ein verhaltenes
Schmunzeln über das Gesicht. Doch Jablonski sah rücksichtsvoll in eine andere
Richtung und presste die Lippen zusammen.
Von der Schweriner Straße aus bog er links ein in die Stapelfelder Straße ein,
vorbei an der Tankstelle, in der sich Leutnant Schlapphoff regelmäßig seine
Tageszeitung, Zigaretten und einen Flachmann holte. Letzteres verschwand recht
schnell in seiner Jackentasche, um nicht Gefahr zu laufen, dass ihn irgendein
Soldat dabei erwischte. Dabei war es längst ein offenes Geheimnis, dass dieser
Leutnant ein Alkoholproblem hatte.
Auf der Sieker Landstraße kamen Jablonski schon die ersten Bundeswehr-Lkws
entgegen, die sich bereits vor Dienstbeginn in Marsch setzten mussten, um nicht
in den morgendlichen Stoßverkehr zu kommen.
Als er nach kurzer Ausweiskontrolle das Tor durchschritt, reihten sich gerade die
Wachen auf um sich für die morgendliche Flaggenparade bereit zu machen. Das
wiederum beflügelte einige Soldaten, sich schnell aus dem Staub zu machen,
damit sie nicht während der Flaggenhissung mit Ehrenbezeigung zum Fahnenmast
stehen bleiben mussten.
Er musste aufpassen, dass ihm nicht Hechler oder ein ähnlich diensteifriger
Gruppenführer begegnete. Denn er hatte keine Heimschläfergenehmigung und
durfte demnach gar nicht außerhalb der Kaserne übernachten. Es war den
Soldaten aber erlaubt, lange vor Dienstbeginn die Kaserne zu verlassen, um
Besorgungen zu machen. Für den Fall der Fälle hatte Jablonski natürlich
vorgesorgt. Seine Stubenkameraden waren stets bereit zu bezeugen, dass ihr
Kamerad auf seiner Stube war und er früh aufstanden war, um etwas zu besorgen.
UvD und Wachen scherten sich ohnehin nicht darum. Im Zweifelsfall hätten auch
sie jede Aussage ihres Sanitätsgefreiten bestätigt oder sich nicht mehr daran
erinnern können.
Wie an jeden Montagmorgen war der Warteraum des San- Bereichs überfüllt. Die
Zahl der Simulanten hatte sich aufgrund des Fünfundzwanzigers fast verdoppelt.
Die Symptome waren alle ähnlich. Fuß- und Kniebeschwerden waren die
typischen Erkrankungen, die ohnehin schwer nachzuweisen waren. Gelegentlich
wagte es auch einer mit dem Kreuz. Der Stabsarzt sorgte dann mit ein paar gut
gemeinten Spritzen in den Rücken für rasche Hilfe. Wenn der Soldat
anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht heraustrat, hielt er die anderen
heilend davon ab, die gleichen Beschwerden anzugeben. Scheinkranke meldeten
sich grundsätzlich am Anfang der Woche in der Hoffnung, eine Marsch- und
Sportbefreiung zu erhaschen. Andere wiederum hatten den Dreh heraus, sich
bestrahlen zu lassen. Möglichst morgens, damit sie ein bisschen Schlaf
nachholen oder sich den morgendlichen Appell entziehen zu konnten.
Je mehr sich eine Woche dem Ende neigte, um so echter waren die Kranken. Wer
sich auf einen Freitag krank meldete, musste damit rechnen, auf die Station des
San-Bereichs gelegt zu werden. Verständlich, dass man das Wochenende über die
Zähne zusammenbiss und sich das mögliche Malheur für den Montag
aufbewahrte.
Jablonski gab meistens immer die gleichen Medikamente heraus: Mobilat und
Heruduisalbe, die gut und teuer waren. Das Dumme daran war, dass sie später
ungenutzt im Spind oder zivilen Hausapotheken lagen.
An diesem Tag hatte Jablonski UvD und war daher auch für die Mahlzeiten der
im San- Bereich liegenden Patienten verantwortlich. Der UvD Dienst dauerte von
12 bis 12 Uhr. Normalerweise hätte er den morgigen Marsch gar nicht mitmachen
brauchen. Aber der freie Tag war ihm wichtiger. Dem Oberfeldwebel hatte er im
Laufe des Vormittags das Versprechen abgeluchst, den möglichen Tag
Sonderurlaub schon am Freitag nehmen zu dürfen. Der San-Gruppenführer war
nicht weniger stolz, dass sich auch einmal ein Sanitäter um Leistung bemühte.
Der Tag verging stupide und ereignislos wie unzählige andere auch. Der einzige
Unterschied war, dass einige erfolglose Simulanten der Ersten die Tauglichkeit
ihres Stabsarztes infrage stellten. Ab 17 Uhr trat im San-Bereich Ruhe ein.
Kameraden und Vorgesetzte verdrückten sich pünktlich und Jablonski suchte
sich, nachdem er die Kranken auf der Station versorgt hatte, eine Beschäftigung.
Erst räumte er sein Behandlungszimmer auf, dann sah er mit ein paar Kranken
fern und zum Schluss legte er sich schließlich auf das Bett im UvD- Zimmer und
las ein Buch.
Spätabends gegen 23 Uhr ging er noch einmal nach draußen um ein wenig frische
Luft zu schnappen. Es war kühl und der bedeckte Himmel verschluckte das Licht
des Mondes. Unzählige Mücken tanzten um die Laternen. Ein leichter Wind
bewegte die Blätter des Rhododendronbusches links vom Eingang.
„Hallo Sani!“, grüßte ihn plötzlich jemand aus der Dunkelheit. Jablonski erkannte
zwei Wachsoldaten der Ersten, die in das Neonlicht des Eingangs traten. Beide
waren Reservisten wie er, die vom Soldatendasein genug hatten. Ausgerechnet
Unteroffizier Hechler war ihr Wachhabender und sie erzählten, wie sie unter
seinen Schikanen zu leiden hatten. Er kontrollierte seine Streifen auf Schritt und
Tritt, duldete keine Kippen im Aschenbecher und kein überflüssiges Wort mit
den Arrestanten. Aus jeder gewöhnlichen Wachablösung machte er einen
Staatsakt, kontrollierte Kleidung und Wissen über das Verhalten einer Streife.
Am meisten hatte der Posten am Schlagbaum zu leiden. Dieser war angehalten,
jeden rein- und rausgehenden Soldaten zu überprüfen, egal wie gut er ihn kannte.
Hechlers stichprobenartige Fragerei nach Namen und Einheit verunsicherten ihn
jedes mal. Wer konnte sich schon drei oder vier Namen mit Kompaniezugehörigkeit
merken? Er scheute nicht einmal davor zurück, den unkontrollierten
Passierenden mit dem Rad zu verfolgen, um sich dessen Truppenausweis zeigen
zu lassen.
„Das Schlimmste ist“, erzählte der Eine, „mein Kumpel sitzt in der Arrestzelle
Читать дальше