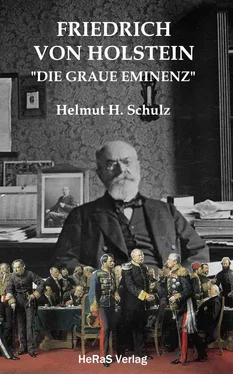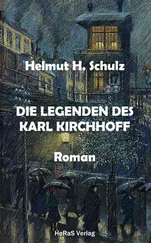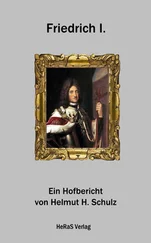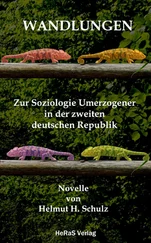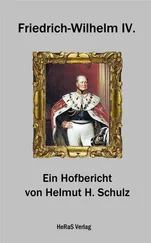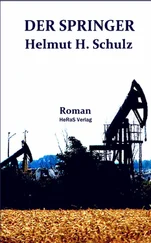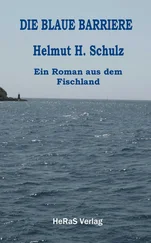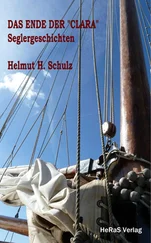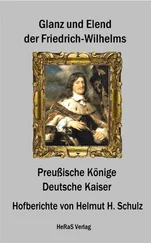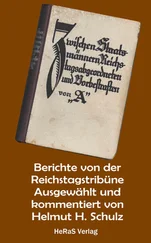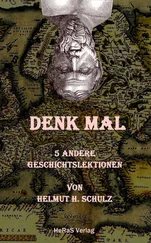Die Aufzählung seiner Vergehen ist unvollständig, obschon es kaum denkbar erscheint, dass ein Beamter, wenn auch ein hoher, all dies allein verschuldet haben könnte, Ministerstürze, Berufungen und Bestrafungen, ohne dass sie ihm auf die Sprünge gekommen waren und ihn einfach rausschmissen. Nein, sie waren ihm alle zu ähnlich, nur dass ihnen die Konsequenz fehlte, ihren Machttrieb auszuleben. Sie wollten mit all ihren Fehlern von ihren Mitmenschen geliebt sein! Die dunkle Seite seines Wesens, der verborgene Anarchist, trat spät zutage. Beide Bismarcks haben ihn zuletzt, als seine Eskapaden immer grotesker und unerklärlicher schienen, einfach für verrückt gehalten. Der Altkanzler hatte einmal bemerkt, als ihn die Klagen über den Legationsrat erreichten, dass nur er mit Holstein fertig geworden sei. Und daran ist etwas Wahres, wie sich nach der Entlassung Bismarcks herausstellte. Sie wurden nicht mit ihm fertig; er machte ihnen die Außenpolitik, deren Fehler sie mit ihrem Titel decken mussten!
Als sie in Mode gekommen waren, reihten die Psychoanalytiker Holstein unter die Psychopathen ein, weil sie ihn nicht verstanden und auch nicht damit rechnen konnten, dass er sich zur Beratung auf eines ihrer Sofas legen würde, um ihnen Rede und Antwort zu stehen, ob ihn seine Mutter vernachlässigt hatte, oder ob ihn sein Vater missbraucht habe. Lange hätten sie nicht suchen müssen. Wirklich hat Holstein eine lieblose Kindheit gehabt. Dafür steht die Erzählung seiner Haushälterin, die Holstein als alten Mann in Tränen ausbrechen sah, als ihn nach Jahrzehnten seine treue Amme in Berlin aufsuchte, einfach nur zu Besuch kam, zu ihrem geliebten Milchsohn! Er aber konnte, bei der Erinnerung an glücklichere Zeiten, nicht an sich halten! Sie fanden aber heraus, dass er an einer Paranoia litt, einem störrischen Größenwahn, eine seit dem Altertum beobachtete Geisteskrankheit, bei Kaisern und Vasallen häufig. Sie forschten vergeblich nach den Ursachen; im Grunde litt das zu Ende gehende Jahrhundert insgesamt an der Übersteigerung des Lebensgefühls, einem, nicht-wissen-wohin-mit-sich.
Die Vorwürfe mehrten sich: verfehlte Beratertätigkeit, wenn es um die Besetzung hoher staatlicher Ämter ging, um die Wahl eines Nachfolgers in irgendeinem Amt; abgefeimte heimliche Wühltätigkeit gegen Vorgesetzte, ihm sozial Überlegene, oder auch einfach Ausdruck seiner indifferenten Angstzustände, persönliche Racheakte gegen Personen, von denen er annahm, dass sie ihm geschadet hatten oder ihm schaden könnten. Treulosigkeit, und in einem Falle der Diebstahl persönlicher Briefe mitsamt einer Schatulle aus dem Hotel »Bristol«, in das Bülow, damals noch Botschafter in Rom, und seine Gattin, die »Contessina«, zu einem sogenannte »Tee mit Schleppe« geladen hatten. Was darunter zu verstehen ist, wenn nicht ein Empfang, ein Jour fix, ist leicht zu erraten. Viel Kultur, oder was die Clique darunter verstand, auch unterhaltende Musik, viel Anekdote, kurz, die aufgelockerte Langeweile der Gesellschaft. Die Contessina entstammte einer der ältesten italienischen Adelsfamilien; sie hatte sich scheiden lassen, um sich mit Bülow zu vermählen, nach einem langen Rechtsstreit und dem Dispens Seiner Heiligkeit; für eine Katholikin der einzige Weg, eine neue Ehe zu schließen. Dazu musste die frühere Beziehung für ungültig erklärt und annulliert werden. Das Paar besaß in Berlin keine Wohnung und befand sich auf der Durchreise ins Seebad nach Norderney. Für ihren Tee mit Schleppe nutzte die Contessina das Hotel »Bristol«. Der Diebstahl machte Aufsehen, aber die Bülows machten überhaupt Aufsehen.
An und für sich vermied es Holstein, sich in Gesellschaften zwanglos zu zeigen; aus irgendeinem Grunde aber hatte er die Einladung der Bülows angenommen und sich als Original bestaunen lassen. Nun fiel der Verdacht des Diebstahls auf ihn. Es handelte sich um die »Tausigbriefe«, intime Schriftstücke von der Hand der Dame des Hauses, Liebesbriefe an ihren Klavierlehrer, in ihrer Jugendzeit verfasst, längst vergangen und olle Kamellen. Vergangen? Keineswegs, da niemand die Brieftexte kannte! Und also gern gewusst hätte, was sich ein Klavierlehrer und eine seiner Schülerinnen neben den Übungen auf der Tastatur zu sagen und zu schreiben hatten. Weshalb lagen sie herum, und nicht unter Verschluss gehalten, wenn ihr Inhalt kompromittierend war? Ob Holstein im Besitz der Briefe war, blieb ungeklärt, ist aber wenig wahrscheinlich. Angeblich fand sich die Schatulle mit den Briefen auch wieder an. Bemerkenswert an dem Vorfall ist, dass die Teegesellschaft einem Legationsrat den Diebstahl zutraute, da doch alle in Verdacht kamen. Bülow hat sich übrigens für die unsinnige Verdächtigung bei Holstein entschuldigt.
In den oberen Kreisen der Gesellschaft wurde viel musiziert; es war eine adlige Freizeitbeschäftigung, zu Hause geübt, auf ein Klavier einzuschlagen, schlimmstenfalls zu komponieren, wie weiland der Prinz Louis-Ferdinand, oder der Alte Fritz oder König Friedrich Wilhelm II., dessen Spiel auf dem Cello sogar einen Beethoven beeindruckt haben soll. Andere Nachrichten über den königlichen Virtuosen gibt es nicht. Indessen schmückten sich natürlich auch die bürgerlichen Salons mit ihren musischen Entdeckungen, mit Pianisten zumal, mit Geigern, daher die Bezeichnung Salonmusik, den Violinvortrag, von einen Pianisten begleitet. Wem fällt hier nicht der Namen Paganini ein oder Ludwig Spohr? Auch der größte Salon war zu klein für ein großes Orchester. Auch wurden die Mittel knapp, sich ein Orchester zu leisten. Der Botschafter Harry Graf von Arnim konnte komponieren, er konnte sich selbst präsentieren; der Botschafter Eulenburg konnte es auch. Bismarck konnte es nicht, und er war misstrauisch, was diese adligen Schauobjekte betraf. Jeder Politiker, dem es an einer diplomatischen Karriere lag, und der zugleich öffentlich Klavier spielte, wie ein Zirkusartist, der auf einem Seil tanzt, war ihm verdächtig. Er genoss es aber, wenn seine Frau gelegentlich für ihn allein spielte, Bach, wie berichtet wird; es beruhigte ihn. Ein anderer Komponist als Bach würde die Nachwelt auch enttäuscht haben. Die vollendete Ausgewogenheit der Kompositionen Johann-Sebastians hätte zu dem Rationalisten Bismarck gepasst, falls diese Mitteilung verbürgt ist. Die Fürstin; nun, sie war offenbar mit dem Beifall ihres Gatten zufrieden. Wohl wahr, dass immer alles auf Zeit und Umstände, auf das richtige Maß ankommt. Der Reichskanzler spielte vornehmlich Reichstag und nicht Piano. Dem Nachgeborenen fällt die Psychologie des Zeitalters auf, das ständig Gereizte, das Übersteigerte der Gesellschaft des Kaiserreiches, die Hektik und die Unsicherheit der Entscheidungen, die Großmannssucht, die Nervosität, von der das politische Leben nach dem Tod des alten Kaiser Wilhelms 1888 gleichsam durchfiebert war. Man dachte in Superlativen, in Steigerungen, groß, größer, am größten und am größesten! Im »Untertan«, nach dem Romanentwurf von Heinrich Mann, sieht der Jurist und Schauspieler Wolfgang Buck den Kaiser in der Rolle eines Mimen; das deckt sich mit dem Eindruck eines Diplomaten, der Kaiser wolle überall auffallen. Der Schauspieler hatte sich der politischen Tribüne bemächtigt. Umgekehrt posierte die Politik im Plenarsaal des Reichstages wie auf der Bühne eines Theaters. Weiter fällt der permanente Angstzustand auf, Angst vor dem feindlichen Nachbarn, der jederzeit zum Militärschlag ausholen konnte, gegen den man sich durch Dutzende Abkommen sicherzustellen suchte. In keinem Zeitalter zuvor waren eine solche Menge sinnloser Beistandsverträge geschlossen und natürlich gebrochen worden, Sicherheit vortäuschend. Die großen europäischen Monarchien lagen in Konkurrenz miteinander, im Felde, im Ballsaal, bei feudalen Segelregatten. Indessen das, was man damals als »Proletariat« bezeichnete, in ihrem Schatten gedieh, das, groß geworden und durch den Krieg bewaffnet, zum Untergang der alten Großreiche nicht wenig beitrug und diese durch fragwürdige Republiken ersetzte, in denen nicht weniger posiert wurde. 1887 schrieb einer der Kulturkritiker jener Zeit, Albert Lange die »Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart«; das Buch wurde gelesen, es leitete direkt zu Sigmund Freud über, der dem Zweckgefühl einen Namen gab, Nervosität.
Читать дальше