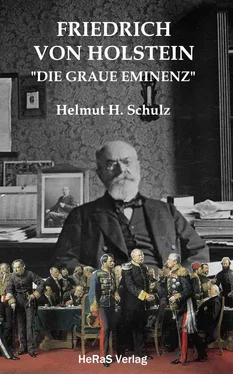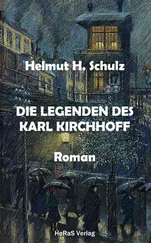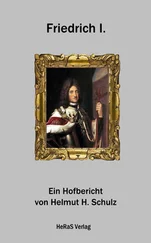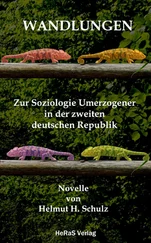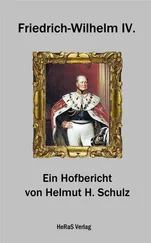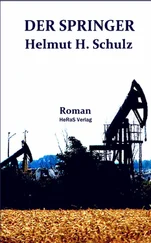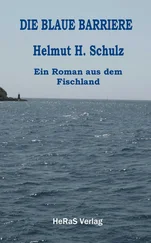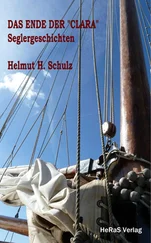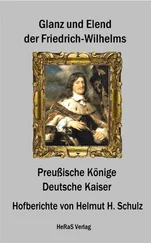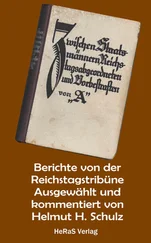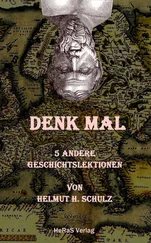Der hohe Diplomat Harry von Arnim, ein Liebling der kaiserlichen Gesellschaft, eine vornehme Figur, Künstler, Komponist, intrigant, reich, unabhängig, arrogant und unbedenklich in seinen Unternehmungen, fiel von der Hand Holsteins. Am Ende entscheidet immer die Persönlichkeit. An dem frühen Tod des Grafen, sprachen seine Standesgenossen Holstein gnadenlos schuldig, es war eine Sünde ohne Vergebung. Die Affäre Arnim holte den Rat, den »Henker Arnims«, immer wieder ein; nein, sie hat ihn seit seiner Lebensmitte begleitet und seine Handlungen beeinflusst. Einen tiefen Bruch, eine letzte Wandlung im Leben dieser Sphinx, wurde durch das Ränkespiel um den »Rückversicherungsvertrag« eingeleitet, Bismarcks Lebenswerk. Als die Frist zur Verlängerung des Abkommens abgelaufen war, schien Holsteins Anteil an der Entscheidung mit Russland zu brechen, immerhin bedeutend, obschon er selbst vehement bestritt, den Vertrag, der Europa kurzfristig ein stabiles Miteinander gesichert hatte, hintertrieben zu haben. Aus persönlichen Briefen Bismarcks an ihn wollte er belegen können, dass er im Gegenteil für die Verlängerung des Vertrages gestimmt habe. Nur, die Tatsachen sprechen dagegen, was auch immer in den Briefen stand.
Bismarcks Nachfolger, Graf Leo von Caprivi, in dessen Amtszeit die Verlängerung des Abkommens fiel, viel mehr, gefallen wäre, bemerkte einsichtig, er sei nicht in der Lage, wie Bismarck mit fünf Bällen zugleich zu spielen, von denen drei immer in der Luft seien. Das System Bismarck war für seinen schlichten Geist zu kompliziert, zu komplex, zu oft wechselten die Situationen. Er begriff nicht, dass hinter dem Wechsel ein flexibles Konzept steckte. Der neue Reichskanzler Caprivi war der gewagten Dreiecksdiplomatie Bismarcks nicht gewachsen, wie er selbst wusste; er hielt diese Art Diplomatie, nach eigenem Eingeständnis überhaupt für unfruchtbar. Er, ein aufrechter Mann, der den Kaiser auf seine mangelhaften Erfahrungen in der Außenpolitik aufmerksam gemacht hatte, erhielt die kaiserliche Antwort, »für die Außenpolitik bin ich zuständig«. Ehrlicherweise trat er gelegentlich ab, viel mehr entließ ihn Kaiser Wilhelm mit der Begründung, dieser Kanzler sei ihm zu unbeweglich, zu langweilig, er könne mit ihm nicht arbeiten.
Bismarck hat den ehrlichen alten General für einen befähigten Unteroffizier gehalten, aber in der Praxis war Caprivi nun einmal ein hoher Militär. Generäle mit dem Begriffsvermögen von Wachtmeistern mag es häufiger gegeben haben. Es gibt sie auch heute; sie sind nicht ausgestorben, sondern unsterblich. Feldherr ist kein Lehrberuf; Diplomat im Grunde auch nicht. Als dem Kaiser Napoleon I. die Beförderung eines seiner Offiziere zum General vorgeschlagen wurde, fragte der Imperator schlicht: »Hat er Fortune?« Er wusste, wovon er redete; als ihn sein Glück verlassen hatte, begannen die Niederlagen. Glück kann man auch nicht lernen; man hat es, allerdings meist nur zeitweise. Dann geht das Privileg auf einen anderen, meist einen jüngeren über. Dennoch hatte Caprivi Gelegenheit, während seiner Amtszeit die Entlassung Bismarcks zu betreiben, sie zumindest nicht zu verhindern gesucht, sicherlich ohne zu wissen, was er tat, ein braver Mann und ein gehorsamer alter General.
Der Altkanzler hatte von seinem Ruhesitz Friedrichsruh aus beobachtet, was sich in Berlin tat, wie die Nachfolger mit seinem Lebenswerk umgingen und wie sie es schließlich ruinierten. Vor Eintritt der Katastrophe schloss er die Augen. Zweifellos hat Friedrich von Holstein die Entfernung des Reichskanzlers, seines Lehrmeisters, ungeachtet seiner langen und engen Freundschaft zur Familie Bismarck, mitbetrieben; es war für ihn eine Überlebensfrage über die Ära Bismarck hinaus zu bleiben, wenn dessen Sturz unvermeidlich war, wie Holstein erkannt hatte. Im Grunde wird er den »Rückversicherungsvertrag«, die Konstruktion Bismarcks, weder für zu komplex, noch für zu kompliziert gehalten haben, wie er unter anderem vorgab. Nur beurteilte er die europäische Bündnislage 1890 anders als zur Zeit des Abkommens drei Jahre zuvor, und er stand mit seinem Urteil über das »Russenabkommen« beileibe nicht allein. Voller Überzeugung erläuterte einer der Staatssekretäre im Außenministerium, von Marschall, dem Reichstag die Gründe, die zur Ablehnung der russischen Wünsche nach Verlängerung des Abkommens geführt hatten; es sei immer misslich, sich nach zwei Seiten hin zu binden, weil man sich in einem solchen Vertrag nur gegenseitig schwäche. Ja, aber genau darauf hatte doch das Konzept Bismarcks beruht, sich gegenseitig zu binden; er wollte keine »Erwerbsgenossenschaft« bilden, sondern die Interessen des einen an die des anderen binden, sodass sich ein überraschender Präventivschlag, ein Überfall nicht lohnte! Gleich nach Abschluss der Vereinbarung wurden die Früchte sichtbar; auf dem europäischen Festland war nichts zu holen, so wendete sich die Diplomatie anderen Weltgegenden zu. Die europäischen Westmächte hatten ein anderes, ein ausbaufähiges Objekt ihrer Begierde entdeckt, den Erwerb ihrer Kolonialreiche! Womit sich die Politik vom Balkan ins Mittelmeerbecken erweiterte, wo in er Tat die Rückversicherung nichts mehr nutzte!
Endlich soll Holstein den Kaisergünstling, den Fürsten Philipp zu Eulenburg-Hertefeld zur Strecke gebracht und damit die schwerste innere politische Krise des Kaiserreiches und Zweifel in die Glaubwürdigkeit seiner Führer, der Fürsten und Junker ausgelöst haben. Die Reihe der Prozesse, die den Kaiser bloßstellten und die Rolle Eulenburgs beendeten, seien Holsteins Werk gewesen. Der Legationsrat hatte in seinen letzten Lebensjahren beide, Kaiser und Harlekin, Wilhelm und Eulenburg, bekämpft, weil er sie, weil er das System für ein Unglück hielt. Fünf Jahre nach seinem Tode, brach der Erste Weltkrieg aus und beendete alle Bündnisse. Das »Palasthündchen«, wie seine Freunde und seine Feinde den Fürsten Eulenburg nannten, hatte ausgebellt, lebte aber gleichwohl noch lange weiter.
An Eulenburg hatte Holstein ein gewisses beobachtendes, misstrauisches und zurückhaltendes Interesse gefunden. Für die Vorzüge und Begabungen Eulenburgs nicht blind, war er ihm ein guter Ratgeber gewesen, und schrieb doch korrekt auf, was er über ihn in Erfahrung bringen konnte, einem schwer Homosexuellen, der seine Beziehungen, zu Schwulen und Okkultisten nicht mehr unter Kontrolle hatte. Holstein leistete denn auch einen erheblichen Beitrag, den Invertierten, den Schädling zur Strecke zu bringen, freilich mithilfe eines ihm, Holstein, ähnlichen Journalisten, Maximilian Harden, alias Witkowsky, einem der gewissenlosesten Pamphletisten und übelsten Schandmäuler des Kaiserreiches. Wollte der Geheimrat im Ruhestand Holstein, Eulenburg und nach ihm die kaiserliche Majestät beseitigen? Unglaublich, aber vieles ist an diesem Leben seltsam widersprüchlich. Noch als alter Mann forderte Holstein Eulenburg zum Duell, das natürlich nicht ausgetragen wurde, weil der Fürst eine Ehrenerklärung abgab. Darüber wird noch zu reden sein. Feige war dieser Holstein nie, er forderte überhaupt leicht, wenn er beleidigt worden war, also im Grunde oft und regelmäßig. Dem Vortragenden Rat im erzwungenen Ruhestand, einem nur aus der Ferne lenkenden Beobachter, wurde angelastet, den Kaiserintimus vom Sockel gestürzt und aus den Wonnen der großen Politik in die Isolierung und Einsamkeit seines Schlosses Liebenberg vertrieben zu haben. Wo er friedlich, schwer krank im Schlosspark wandelte, sich auf einen Stock stützend.
Zu Herbert von Bismarck, dem Sohn des Altkanzlers, einem Staatssekretär im Auswärtigen Amt, zu Bülow, selbst zu Eulenburg und zahlreichen anderen hatte Holstein das Duzverhältnis gesucht und es lange aufrechterhalten; er ließ seine Freunde fallen, wenn ihre Zeit abgelaufen war oder wenn er ihrer Loyalität nicht mehr vertraute. Im Grunde hatte er recht; seinen Erfahrungen nach, waren sie alle zu jeder Stunde des Verrates fähig, wenn sie sich einen Nutzen versprachen. Alle schätzten seinen Scharfsinn, und alle fürchteten, wie kleine Jungen den Rohrstock des strengen Lehrers, die gnadenlose Bestrafung ihrer Fehler und ihrer Unterschleifen. Sie alle hatten etwas auf dem Kerbholz. Im Senat Roms hätte Holstein das Amt eines Zensors bekommen, in der Französischen Republik das eines Kriegskommissars vom Range eines St. Just.
Читать дальше