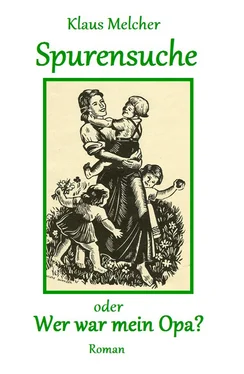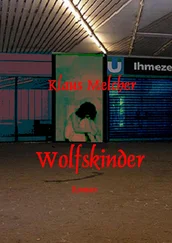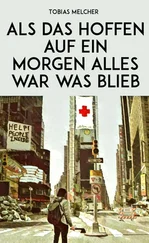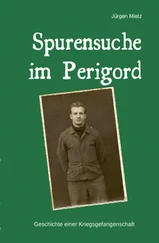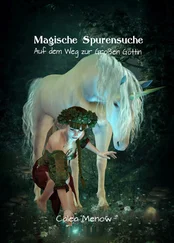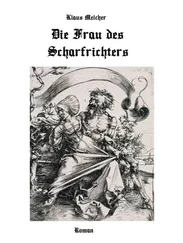Wer hier bestattet wurde, hatte kein Geld für eine bessere Grabstelle. Oder er wollte oder sollte vergessen werden, aus welchem Grunde auch immer.
Kaum jemand würde ihn auf seinem letzten Weg begleiten. Es gab keinen Platz für eine Trauergesellschaft. Wer kam, würde sich in der Kapelle verabschieden müssen – und später wahrscheinlich nie den Weg in diese abgelegene Gegend finden.
Wen wundert es, dass diese Grabstelle noch nicht wieder belegt war. Seit zwei Jahren war sie abgelaufen.
Nachdem keine Hinterbliebenen in Erfahrung gebracht worden waren, die sie hätten verlängern können, hatte die Friedhofsverwaltung das Grab einebnen lassen. Den Grabstein hatte der Steinmetz entfernt und mit seinem Aufwand verrechnet. Jetzt lag er auf seinem Betriebshof und wartete darauf, abgeschliffen und wieder verkauft zu werden.
Die Inhaber des Mausoleums, eine gewisse Familie Möller, hatten den freien Platz als Versteck für alles mögliche Gartengerät entdeckt und nutzten ihn eifrig, nachdem sie auch ihre herrschaftliche Grabstelle in den letzten Jahren und Jahrzehnten sträflich vernachlässigt hatten.
Aber nach dem Krieg hatte man zunächst andere Sorgen. Man war schon froh, dass die Platane den Winter 1946/47 unbeschadet überstanden hatte. Wahrscheinlich war sie den Holzdieben schon zu groß, um gefällt zu werden. Jedenfalls besondere Maßnahmen zum Schutz des Baumes hatte die Familie Möller nicht ergriffen. Sie hatte Berlin mit unbekanntem Ziel verlassen.
Wer auch immer seit einigen Jahren das Grab in Ordnung hielt - pflegte wäre zuviel gesagt – der hatte sich auch der Grabstelle auf der Rückseite bemächtigt. Sogar eine Gartenkarre hatte er dort deponiert, zugedeckt durch eine grüne Plastikplane. Laub und abgeschnittene Efeuranken wurden nicht mehr in die Grüncontainer gebracht, sie wurden einfach auf die Rückseite geworfen.
Die Grabstelle H 23 war ein Bild des Jammers und hätte ganz sicher den Zorn der Nachbarn erregt und zur Beschwerde bei der Friedhofsverwaltung geführt, wenn, ja wenn überhaupt jemand diesen Winkel je betreten hätte.
Ausgerechnet diese Grabstelle steuerte eine Gruppe von drei Frauen an. Sie sahen nicht aus wie übliche Friedhofsbesucher, trugen keine Blumen oder Geräte mit sich, schritten energisch aus, als wären sie in Eile.
Voran ging die Älteste.
Ab und zu sahen sich die beiden Frauen, wohl Mutter und Tochter, die im Schlepptau der Alten gingen, fragend an, schüttelten den Kopf und versuchten sich vor dem alles durchdringenden Novembernebel zu schützen, den Kopf tief in den Kragen und Schal eingezogen.
Kurz hinter dem kleinen Pavillon zu Ehren der Königin Luise verließen die Frauen die breite Kastanienallee und bogen nach rechts auf einen der vielen Hauptwege ab, die sich immer weiter verästelten, bis sie zu den einzelnen Grabfeldern führten.
Als sie einen der zentralen Kompostcontainer erreicht hatten, bogen sie vom Hauptweg ab, schritten durch eine Reihe gepflegter Gräber und kamen in die
Reihe H.
Mühsam zwängten sie sich an den Büschen vorbei und blieben an dem eingeebneten Grab stehen.
„Das ist es“, sagte Elisabeth von Wernher.
Ungläubig sah ihre Tochter sie an.
„Das ist doch nicht dein Ernst.“
„Und warum nicht?“
Elisabeth von Wernher war es nicht gewohnt, dass man ihr widersprach oder ihre Entscheidungen in Frage stellte. Das hatte es nie gegeben und würde es nie geben.
„Hier will ich liegen und nirgends woanders. Hier habe ich meine Ruhe!“
Damit war das Thema erledigt.
Elisabeth von Wernher drehte sich auf dem Absatz um und trat auf das Grab, um an ihrer Tochter und Enkelin vorbeizukommen. Ihre Füße versanken in dem aufgeweichten Boden, der links und rechts an ihren Schuhen empor quoll.
Wieder auf dem schmalen Weg, stapfte sie zweimal auf, und als der Schlamm noch immer an den Sohlen klebte, suchte sie eine einzelne Grassode und strich ihre Schuhe ab. Unzufrieden mit dem Erfolg, ging sie den gleichen Weg unterhalb der Mauer zurück.
Als sie auf dem Hauptweg angekommen war und der Blick auf das Mausoleum frei war, sah sie kurz in die Richtung, murmelte etwas Unverständliches und übernahm wieder die Führung.
An dem Luisen-Pavillon hatten die beiden jüngeren Frauen sie endlich eingeholt.
Inmitten im Wind torkelnder trockener Kastanienblätter war sie stehen geblieben, völlig außer Atem. Sie würdigte ihre Tochter und Enkelin nur eines kurzen Blickes.
„Ich habe noch was zu erledigen. Also dann bis später.“
Sie nickte den beiden Frauen zu und eilte in Richtung Haltestelle.
Unmittelbar nachdem sie in den wartenden Bus gestiegen war, setzte er sich in Bewegung und fuhr in Richtung Innenstadt.
„Verstehst du das?“
Anneliese von Wernher sah ihre Tochter an.
Julia schüttelte den Kopf.
Zwar war ihr ihre Großmutter schon immer sehr fremd gewesen, gefühlskalt war sie, egoistisch und herrschsüchtig; aber sie hatte sich bisher wenigstens immer den Anschein gegeben, ihre Meinung zu begründen. Auch wenn sie Widerspruch nicht zuließ.
Und auf einmal tat ihre Mutter ihr leid.
Friedrichshagen, Juni 1913
Elisabeth von Wernher wurde am 15. 11. 1923 als drittes Kind eines verarmten Adelsgeschlechts in Friedrichshagen bei Oranienburg geboren.
Der Großvater war als Offizier im Preußischen Garderegiment sehr spendabel gewesen und hatte gerne, aber erfolglos gespielt. Als er feststellte, dass nicht nur sein Portemonnaie leer war, sondern auch von seinem Familienbesitz wenig übrig geblieben war, quittierte er den Dienst und kehrte nach Friedrichshagen zurück, in der Hoffnung, wenigstens noch etwas retten zu können.
Den Mut, seiner Frau zu sagen, dass er nun immer hier bleiben würde und dass ihr Schicksal sehr ungewiss wäre, hatte er nicht. Stattdessen gab er bei seiner Ankunft ein opulentes Abendessen für den übernächsten Abend in Auftrag und ließ seine Nachbarn zu dem Fest seiner Rückkehr einladen.
Nachdem er die notwendigen Briefe geschrieben und Instruktionen erteilt hatte, ging er durch das weitläufige Gutshaus, das eher an ein Schloss erinnerte.
Im breiten Westflügel, der dem Spiegelsaal in Versailles nachempfunden war, blieb er stehen.
„Das war es also“, sagte er und drehte sich um. Die Vasen, die kleinen Statuen, die Leuchter – all das war nicht mehr seins.
Kameraden, die ihn an den vielen Abenden im Offizierscasino besiegt hatten, würden sie hinaustragen, unter den mitleidigen Blicken des Personals.
Und was noch schlimmer war, die Bankiers, die ihm erst ermöglich hatten, durch ihre großzügigen Kredite auch außerhalb des Offizierscasinos zu spielen, zu bedeutend höherem Einsatz, die würde man zwar nicht sehen. Aber man würde sehen, wenn sie – fernab in Berlin – mit einem Federstrich sein Schicksal und das seiner Familie besiegelten.
Achim von Wernher betrachtete sich in einem der Spiegel der Spiegelwand.
„Das war es also“, sagte er noch einmal. „Und keine Hoffnung?“
Er wusste, dass es keine Hoffnung gab. Zwar hätte er seinen Schwiegervater bitten können, ihm eine gewisse Summe zu leihen, sein Bruder hätte ihm sicher auch geholfen, aber er hätte sein erbärmliches Scheitern eingestehen müssen. Und diese Blamage wollte er sich ersparen.
An seine Familie hatte er dabei nicht gedacht. Einmal nur kurz, als er sich sagte, es wäre für sie besser, nicht mit einem Bankrotteur leben zu müssen. Aber das war, wenn er ehrlich war, nicht sein wahrer Grund für den Schritt, den er für unausweichlich hielt.
Er sah aus einem der Fenster in der langen Westfront. Die Vorhänge waren nicht zugezogen. Man hatte einfach nicht daran gedacht und auch nicht damit gerechnet, dass so spät im Sommer die Temperaturen so ansteigen könnten, und so tauchte die frühe Abendsonne den Saal in ihr goldenes Licht.
Читать дальше