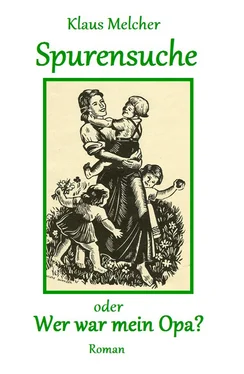Bei uns war es ungeschriebenes Gesetz, dass die Erntehelfer bis in den April blieben. Arbeit hatten sie genug. Erst waren sie mit Dreschen beschäftigt, dann haben sie Holz gemacht und schließlich Zäune repariert. Nach der Saat wurden sie dann entlassen. Aber den ganzen Winter hatten sie ein Dach über dem Kopf und wurden versorgt.
Und was hat Ludwig gemacht?
Mehr als die Hälfte hat er rausgesetzt, jetzt mitten im Winter.
Du wirst fragen, was mein Vater dazu gesagt hat. Er wollte seine Zustimmung verweigern, aber da hat Ludwig ihm gedroht, er würde die Arbeit schmeißen. Und mein Vater kann das Gut wirklich nicht mehr alleine führen. Zu lange hat er sich nicht mehr um die wirkliche Arbeit gekümmert. Hier mal ein bisschen Felder abreiten, da mal in den Pferdestall sehen, das war es auch schon. Alles andere hatte ihm Max abgenommen. Und später hatte sich Ludwig immer unentbehrlicher gemacht.
Ich habe die Gesichter dieser armen Menschen gesehen, als sie den Hof verließen.
Und musste weinen. Ich weiß nicht, worüber mehr, ob über die Härte meines Sohnes oder seine Gleichgültigkeit.
Und da habe ich auf einmal etwas Fürchterliches gedacht: Wenn mich Gott – oder irgendeine Macht – vor die Entscheidung stellen würde: ‚Einer von den zwei Männern, Max oder Ludwig kann diesen Krieg überleben. Wen würdest du wählen?’ Ja, wen würde ich wählen? Meinen eigenen Sohn, der mir auf einmal so fremd geworden ist, der eigentlich – entschuldige, wenn ich das so sage – nicht mehr mein Sohn ist? Oder Max, meinen Schwiegersohn, der mir durch seine Liebe zu Clementine – und ihre Liebe zu ihm – so lieb und teuer geworden ist, wie ich es nie für möglich gehalten hätte?
Weißt Du, liebste Freundin, das Schlimme an diesem fürchterlichen Krieg ist nicht nur, dass unsere Männer und Kinder sterben. Ohne jeden Sinn! Genauso schlimm ist, dass alle unsere Empfindungen, unsere Werte durcheinander geraten. Dass nichts mehr so ist, wie es einmal war, jahrhunderte lang.
Manchmal, wenn ich darüber nachdenke, bin ich ganz verzweifelt.
Wer hat denn Recht in dieser fürchterlichen Welt?
Bettina, die ihre Aufgabe darin sieht, Kranken zu helfen, und auf ihr eigenes Leben verzichtet?
Oder Clementine, die weiß, ihr kleines Glück kann ganz schnell beendet sein, noch bevor es wirklich angefangen hat?
Oder Ludwig, der ganz sicher sein Glück finden wird – ja, ich glaube, er wird es am ehesten von uns finden. Und das macht mich traurig. Zornig auch.
Weißt Du, liebste Freundin, was ich so schrecklich finde an unserem Schicksal? Wir sitzen hier in der Heimat, untätig, und warten ab.
Nicht, dass ich in den Krieg ziehen möchte. Ich stelle mir gerade vor, ich mit der Fahne in der Hand vor dem Heer wie auf dem Gemälde ‚Die Freiheit führt das Volk an’ von Delacroix.
Aber dass wir gar nichts tun können, das finde ich so schrecklich. Warten, immer nur warten!
Du kannst Deinen Mann umsorgen, wenn er auf Urlaub kommt. Wie die griechische Frau ihrem vom Krieg heimkehrenden Mann das Bad einließ, ihm die Wunden salbte.
Nicht einmal das kann ich.
Auf wen warte ich? Max? Auf ihn wartet Clementine. Und sie braucht ihn sehr.
Ich hoffe, ich werde mich nie auch nur ein bisschen zwischen die beiden drängen.
Obgleich es mir manchmal schwer fällt. Gerade jetzt im Winter. Wenn die Abende früh beginnen, im Salon das Feuer brennt. Ich nur träume. Da erscheint er mir schon.
Aber ich bin stark genug, ihn wegzuschieben. Er gehört zu Clementine!
Ich bin auch viel zu alt für ihn!
Basta!
Ich hab’ Dich lieb und wünsche Dir alles Gute.
Deine Luise
Dollien, 1916
Lange schien der Krieg die Menschen in der Schorfheide vergessen zu haben. Zwar wurden auch hier Männer jeden Alters einberufen oder hatten sich im ersten Kriegsjahr freiwillig gemeldet. Aber sie waren ja nur vorübergehend weg, würden bald zurückkehren. Wie von einer längeren Reise.
Jetzt, im dritten Kriegsjahr, kamen immer weniger auf Heimaturlaub. Statt ihrer kamen die Verwundeten, die unbrauchbar geworden waren für den Krieg. Die ein Bein verloren hatten oder einen Arm, vielleicht auch beides. Man fing an, sich an ihren Anblick zu gewöhnen.
Es war Krieg. Und der forderte eben seine Opfer. Da konnte man nichts machen.
Schon lange hatte der Baron seine Zuversicht verloren. Stundenlang saß er abends in seinem Zimmer über den Kriegskarten, zeichnete die Fronten neu ein, markierte die Erfolge; aber auch die Niederlagen. Und stellte fest, dass die Front im günstigsten Fall gehalten wurde, meistens aber zurückwich.
Er traf sich nicht mehr mit dem Lehrer, dem Apotheker, dem Arzt und seinen Nachbarn. Er fand nicht mehr den Weg zum Vaterländischen Verein, in dem sie immer noch von dem Sieg träumten, in dem sie jede Niederlage als Beweis für den Durchhaltewillen der Soldaten feierten.
Die Verblendeten!
Stattdessen fand er immer öfter den Weg in die benachbarten Dörfer.
„Na, Petermann, wie geht’s denn so?“, fragte er, als er den einarmigen Bauern traf, den er bei der Ernte immer besonders geschätzt hatte.
„Wie soll’s schon gehen, Herr Baron. Der Arm fehlt eben. Nur Schmerzen macht das Aas. Als wär’s noch dran.“
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn.
„Das werden Sie noch lange haben, haben die im Lazarett gesagt. Daran werden Sie sich gewöhnen. Bei dem einen gehts schneller, bei dem andern dauerts länger. Ist leicht gesagt, finden Sie nicht auch? Aber schlimmer ist der fehlende Arm. Man braucht ihn doch verdammt oft.“
Petermann verzog das Gesicht vor Schmerzen und griff nach seinem Stumpf.
„Jetzt haben sie mir gerade mit dem Bajonett in den Arm gestochen.“
„Ich will sehen, was ich machen kann. Den Arm kann ich Ihnen nicht geben. Und auch die Schmerzen nicht nehmen. Aber vielleicht fällt mir etwas ein“, sagte der Baron und ritt nachdenklich weiter.
Der Sattler hatte die zündende Idee, als der Baron ihm das Problem schilderte.
Mit einer Handbewegung räumte er eine Ecke seines Arbeitstisches frei, griff nach einem Blatt Papier und suchte einen Bleistift.
Als er alles zusammen hatte, zeichnete er einen Pflug und einen Mann, der ihn führte, beide Hände an den Sterzen.
Erstaunt sah der Baron ihn an.
„Der Mann hat nur einen Arm“, wandte er ein.
Ohne etwas zu sagen, radierte der Sattler den linken Arm aus.
„So“, sagte er, „ist das so richtig?“
Wie man sich an den Blick der Kriegsinvaliden gewöhnte, so gewöhnte man sich auch an die Hilfsmittel, die ihnen ermöglichten, ihrem Beruf nachzugehen. Es entwickelte sich in den Dörfern rund um das Gut eine gewisse Solidarität zwischen denen, die der Krieg bisher verschont hatte, und denen, die zu den Verlierern gehörten. Das war nicht selbstverständlich, auch nicht hier in der Uckermark. Aber das Verhalten, man könnte fast sagen: die Fürsorge, des Barons trug sicher dazu bei.
Kaum waren die ersten drei Gurte für Armamputierte fertig gestellt und an die Bauern verteilt, da hatte der Baron eine neue Idee.
Was, so fragte er sich, macht ein einbeiniger Bauer, wenn er pflügen muss? Mit seinem Holzbein kann er nicht hinter dem Pflug herlaufen. Mit einer Krücke schon gar nicht.
Tage und Nächte vergrub er sich in seinem Zimmer, zeichnete und rechnete.
Als er endlich eine Lösung gefunden hatte, eine Art Fuß- oder Beinstütze, die an dem hinteren Ende des Pfluges befestigt wurde und an die der Stumpf geschnallt wurde, gab er es beim Schmied in Auftrag.
Читать дальше