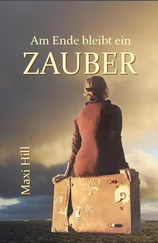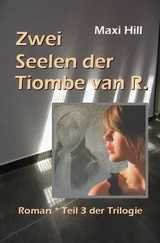Mit gutem Gewissen kann sie es nie beantworten, und das macht sie innerlich wütend. Ist ihre Art Freiheit das, was sie sich erträumt hatte? Freiheit ohne Sicherheit? Sie kennt keinen einzigen Autor in ihrem Umfeld, der vom Schreiben leben kann. Wer gibt noch Sicherheit in dieser Branche? Wenn es in diesem Land noch Sklaven gäbe, Autoren gehörten unbedingt dazu. Sie selbst müsste längst aufgeben, wenn sie Gary nicht hätte. Oder sie müsste betteln gehen ...
Jeder hat schließlich jemanden, der ihm Halt gibt, wenn man es nur will. Ist es womöglich sein Gefühl von Freiheit, das sich Vagabundo zurückerobert hat, aus welchem Grund auch immer?
Vagabundo ! Sie könnte ihn auch Aussteiger nennen. Stromer oder Tramp. Das alles trifft die Sache nicht. Sie kann von sich nicht sagen, dass sie einfallslos ist. In diesem Fall stimmt es. Sie weiß keinen Namen für dieses Vegetieren, dieses Loslassen von dem, woran Menschen sich als Menschen erkennen. Aussteiger? Weiß man, ob einer ausgestiegen ist oder ob ihn die Rasanz der Zeit herzlos abgeworfen hat?
An der Ecke der vielbefahrenen Straße steht das Haus, unscheinbar und scheinbar unbewohnt. Es stammt aus der Zeit, als die Straße noch Flaniermeile war und die Läden noch gerne besucht wurden. Kein einziger ist mehr zu sehen, auf hundert Meter nicht. Der letzte von gegenüber, den eine alte Drogistin nicht eher hat aufgeben wollen, als sie sich selbst aufgab, dient jetzt — düster und mit verdreckten Scheiben — einer autonomen Gruppe als Treff.
Wie sehr sie sich quält, in das Haus zu gehen, erkennt man nicht. Dieser Tag ist weniger kalt, wenn auch feucht. Doch das ist es nicht. Sie ist nicht im rechten Gemüt für ihre Absicht. Sie gehorcht einer Pflicht, ohne die kein Buch auskommt. Wer nicht konsequent verinnerlicht, kann nicht veräußern.
Ohne einen Vorraum zu durchlaufen steht sie sofort zwischen Tischen und Stühlen aus blankem Holz. Am Tresen, der mit roter Klinkertapete beklebt ist, hantiert eine Frau. Ihr Haar hängt strähnig zu beiden Seiten des blassen Gesichtes herab, ihre Augen blicken skeptisch. Wie ein Jäger auf der Pirsch beobachtet sie jeden Schritt, jedes Zucken im fremden Gesicht, das ungebeten näher kommt.
Isa mag so skeptische Gesichter nicht und nicht die Abwehrhaltung dieser Frau. Sie gibt sich keine Mühe, den ungebetenen Gast wieder hinaus zu beordern, weil sie sich offenbar mit nichts Mühe gibt, mit sich selbst schließlich auch nicht.
Gleich siebzehn Uhr. Durch das Fenster kann man die Straße sehen. Autoschlangen reißen nicht ab, so wie der Nebel keine Lücke lässt, der kalt und schwer den Himmel verdunkelt. Die letzten drei Besucher rüsten zum Aufbruch. Dem Mann, dessen Hand in einem weißen Verband steckt, hilft ein anderer, den Rucksack zu schultern. Eine junge Frau ruft ihren Hund, der unter einem der Tische geschlummert hat. Er kommt, schnüffelt artig an Isa und trottet der Frau hinterher zur Tür. Ein schönes Tier, obwohl Isa nicht wirklich ein Gespür für Tiere hat. Hunde sind sogar ihr Angstfaktor Nummer eins.
»André«, sagt die Frau mit dem Hund von der Tür in den Raum zurück. »Komm morgen nicht zu spät.«
»Okay«, grinst der Kerl, an dem Isa irgendetwas bekannt vorkommt. Bevor er wankenden Schrittes in den düsteren Abend geht, murmelt er etwas wie: »… den bestraft das Leben.« Er grinst dazu. Undeutliches Gemurmel auch vom letzten Gast. Grantige Blicke der Frau am Tresen folgen dem Kerl.
»Guten Tag«, sagt Isa endlich ganz ohne Regung. »Ich komme auf Anraten von Frau Deichmann …«
Keine Reaktion. Nur der Blick der Frau wechselt von skeptisch auf gelangweilt. Isa tritt näher.
»Ich heiße Isa-Kathrin Benson, bin Buchautorin und suche das Gespräch mit … Betroffenen.« Gerade noch weicht sie der üblichen Wortwahl aus, weil sie jetzt weiß, was Straßen-Café bedeutet. Ein Café für die von der Straße. Die Frau bleibt versteinert.
»Jetzt ist hier keiner mehr«, sagt das Gesicht, das verfolgt, wie der letzte Besucher auffallend rasch zu Tür hinausgeht. Sein Lauern kann der Blick der Frau dennoch nicht verbergen.
Isa nimmt an, das Gespräch soll damit beendet sein. Auf so plumpe Art lässt sie sich nicht abweisen. Obwohl das Schlüsselbund in der Hand der Frau eine deutliche Botschaft sendet, fragt Isa, wie viele der Betroffenen täglich zu ihr kommen und was genau das Café zu bieten hat.
Es sind nicht viele Worte. Der Wink auf ein Plakat an der Wand muss genügen, dann putzt die Frau mit merkwürdiger Andacht den Tresen.
Es ist gut, denkt Isa, dass jetzt keiner mehr hier ist. Sie mag es nicht, wenn man mit vielen Augen versucht, ihre Emotion zu ergründen. Von dieser Frau mit dem leeren Blick ist das nicht zu erwarten.
Auf einem weißen Blatt stehen ein paar Angebote hinter kleinen verblassten Symbolen:
Ein großer Kaffee: fünfzig Cent. Ein kleiner dreißig. Tee nur zwanzig und auch die Speisen sind erschwinglich. Von einem Euro bis zu einem Euro dreißig.
Kein schlechter Preis. Dennoch. Sie hatte sich vorgestellt, hier gebe es alles gratis. Das wäre auch keine Lösung: Was nichts kostet, ist nichts wert.
Als Buchautorin ist sie mit solidem Verstand ausgerüstet und gewöhnt, sich gewissen Reaktionen gegenüber taub zu geben. Phantastereien rühren sie kaum. Auch Rührseligkeit weckt nur Vorsicht in ihr. Nichts davon bezweckt diese abweisende Frau, die augenblicklich mit Sprache gesegnet ist.
»Ganz unten, das sind die Preise für Duschen und Wäschewaschen. Und daneben, das ist unser Aktionsplan für diesen Monat.«
Isa liest von einem Skatturnier, einem Darts-Turnier und von Osterbasteleien.
»Mächtig Betrieb«, sagt sie anerkennend.
»An kalten Tagen wimmelt es hier nur so …«, erwidert die Frau und hebt erschrocken ihre Lider. Womöglich fällt es ihr selbst auf: Wimmeln passt zu lästigem Kleingetier. Schwärmen. Krabbeln. Wuseln, fällt Isa ein. Überhandnehmen, das wird sie wohl meinen, wie man etwas meint, was einen erdrückt.
»Sie wärmen sich auf, trinken Tee und Kaffee, so das Geld reicht. Wenn nicht, spielen sie Skat oder Tischtennis …« Mit steifem Nacken dreht sie sich um. »…da hinten …«
Während sie spricht, stellt sich eine fiebrige Erregung ein. Ihre Nägel graben sich in den entblößten Unterarm. Beim Hinschauen huscht Isa ein Schauer über die Haut, doch jedes weitere Wort der Frau bringt langsam das Gefühl von Sympathie.
»Wenn das Wetter es erlaubt, grillen wir gemeinsam. Das ist gut gegen die Einsamkeit …«
Isa ist gerührt. Die giftigen Gedanken über die junge Frau sind vergessen.
»Wie viele kommen regelmäßig?«
Der Kopf mit dem blassen Gesicht wiegt zu beiden Seiten.
»Zwanzig. Manchmal vierzig pro Tag.« Und dann sagt sie eine Zahl für das Jahr, die alles wieder infrage stellt. 280? Das kommt nicht hin, doch das wird sie der Frau mit der endlich erwachten Stimme nicht sagen.
»Woher kommt das Geld dafür?«
»Spenden. Aber die sind nicht leicht zu bekommen. Was meinen Sie, wie viel Eigeninitiative nötig ist, um so etwas zu stemmen.«
»Kann ich mir vorstellen.« Sie sagt es so, doch die Worte von Frau Deichmann gehorchten einer anderen Wahrheit. Das Geld komme von der Stadt?
»Manchmal müssen die Besucher auch einen Obolus mitbringen. Wenn wir zum Bowling gehen in die Freizeitoase. Oder für das gemeinsame Frühstück. Das kostet eben.«
»Wie viel genau?«
»Bowling —so um die drei Euro. Das Frühstück ist billiger. Einen Euro glaub ich oder knapp darüber.«
Es hört sich nicht viel an, denkt Isa, aber man muss auch diesen einen Euro aufbringen können. Fast schämt sie sich dafür, dass sie noch immer so wenig über den staatlichen Beistand für diese Menschen weiß. Obdachlos heißt eben nicht, über kein Geld zu verfügen. Kein Obdach im Sinne von ständigem Wohnsitz, das ist das Problem der Menschen, und das nimmt man ihnen auch hier nicht.
Читать дальше