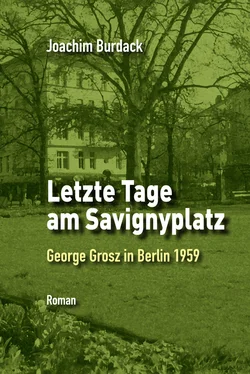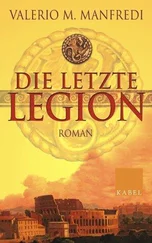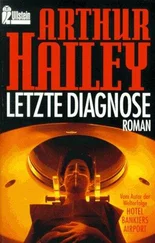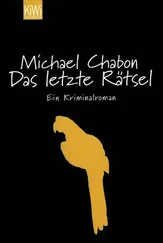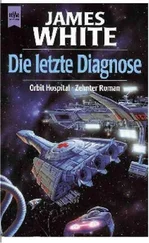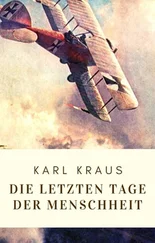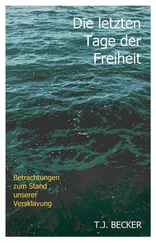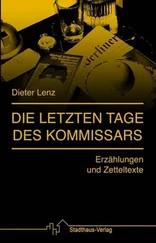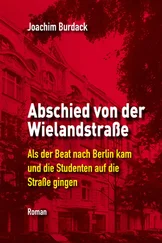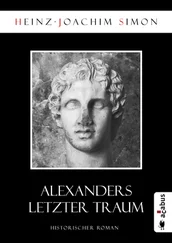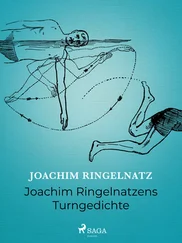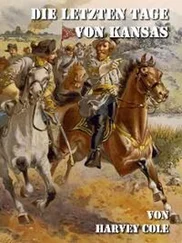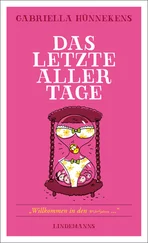Nachdem George den Laden wieder verlassen hatte, ging er ein paar Schritte weiter Richtung Kurfürstendamm zum Haus mit der Nummer 15. Das Gebäude hatte den Krieg unversehrt überstanden. Hier hatte sein Freund und Gallerist Alfred Flechtheim gewohnt. Er war als Jude vor den Nazis geflohen und verarmt in London gestorben. Bei seinen Partys ging es in den zwanziger Jahren immer hoch her. Die Maybach- und Mercedeslimousinen parkten bis hinter die Mommsenstraße. George war oft zu Fuß aus Wilmersdorf herübergekommen. Nur wenn Eva dabei war und sie ihre Garderobe nicht ruinieren wollte, nahmen sie ein Taxi. Bei Flechtheim war immer viel Prominenz zu Gast. Hier hatte er auch Max Schmeling kennengelernt, den er später porträtieren sollte.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite bemerkte George den Laden von Jack Bilbo, einem alten Bekannten. In Käpt’n Bilbos Schatztruhe wurden Kuriositäten aus fernen Ländern angeboten. Jack betrieb auch eine Bar am Kurfürstendamm. Beide Lokalitäten waren aber im Augenblick geschlossen. George nahm sich vor, ein anderes Mal vorbeizuschauen.
Wenig später erreichte er die Ecke Kurfürstendamm und blickte auf das neue MGM-Kino gegenüber: ein modernistischer Neubau mit schwarz glänzender Fassade, der etwas von einem Raumschiff hatte. George hatte den Ku‘damm anders in Erinnerung. Früher war die Gegend sein Kiez gewesen. Sobald er es sich leisten konnte, war er mit Eva in die Nähe des Boulevards gezogen. Für George war der Kurfürstendamm immer das Gegenstück zu dem preußischen Boulevard Unter den Linden in Berlin-Mitte.
War der Linden-Boulevard von Adel und preußischem Militär geprägt, so war der Kurfürstendamm der Boulevard der Bürger. Die monumentale Kulisse der Linden schien wie geschaffen für Militärparaden, die durch das Brandenburger Tor zum Stadtschloss der Hohenzollern zogen, vorbei an vielen staatlichen Prachtbauten und Adelspalais. Hier kam der Einzelne sich klein und unbedeutend vor. Dagegen konnte George sich militärische Aufmärsche auf dem Kurfürstendamm nur schwer vorstellen. Wenn es hier je welche gegeben hätte, so hatte George jedenfalls keine Erinnerung daran. Der Boulevard Unter den Linden stand für Gehorsam und Unterordnung. Darüber wachte der Alte Fritz von seinem Reiterstandbild. Der Ku‘damm dagegen symbolisierte Geschäftigkeit, Vergnügen und Lebensfreude. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet Reichskanzler Bismarck entscheidenden Anteil am Entstehen der Charlottenburger Prachtstraße hatte. Ihm war der geplante Ausbau einer Verbindungsstraße von Berlin zum Grunewald nicht repräsentativ genug. Er erinnerte sich wohl an seine Ausritte in den Bois de Boulogne, als er Gesandter in Paris war. Der Grunewald erschien ihm das Pendant zum Pariser Bois. Deshalb sollte der Kurfürstendamm zu den Berliner Champs Elysées werden - ein schöner ‚ Hauptspazierweg für Wagen und Reiter ‘. Bismarck ließ die ursprünglich geplante Straßenbreite von nur dreißig Metern per Kabinettsorder einfach verdoppeln. Damit hatte der Kurfürstendamm zwar immer noch nicht die Ausmaße seines Pariser Vorbilds erreicht, aber immerhin. Man munkelte, dass Bismarck gerne ein Denkmal am Boulevard des Westens gehabt hätte. Aber der Wunsch wurde ihm nicht erfüllt. George wusste immer zu schätzen, dass der Kurfürstendamm im Gegensatz zum Linden-Boulevard eine denkmalfreie Zone war. Das aufstrebende Bürgertum feierte sich mit protzigen Putzfassaden selbst und brauchte keine Denkmäler vergangener Größe, denn es war sicher, dass ihm die Zukunft gehören würde.
In den Erdgeschossen der Gründerzeithäuser entstanden zahlreiche Lokale und Gaststätten. Vor allem in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bildete sich eine Vergnügungskultur mit Theatern, Cabarets und Caféhäusern heraus, die ihresgleichen suchte. Ein Schriftsteller nannte den Kurfürstendamm damals ‚das größte Caféhaus Europas‘ . Der Boulevard bot alles, was George an Berlin liebte: Kinos, Bars und Betriebsamkeit bis spät in die Nacht.
Aber was war noch übrig von dieser Vorkriegswelt? Die meisten Häuser hatten den Krieg nicht heil überstanden. War der Boulevard nicht zu einer Art umgekehrter Peter Schlemihl geworden? Der hatte bekanntlich sein Schattenbild verkauft. Der Kurfürstendamm war dagegen nur noch ein Schatten seiner selbst. Kinos gab es zwar wieder, aber sie hatten wenig gemeinsam mit den exklusiven Lichtspielpalästen der zwanziger Jahre, die George häufig besucht hatte. Typisch für den Wandel des Kurfürstendamms schien ihm der neue Gloria-Palast zu sein. Vor dem Krieg war dieser das luxuriöseste Filmtheater in Berlin. Der Kinosaal hatte einen Orchestergraben, in dem vierzig Musiker Platz fanden, um Stummfilme zu begleiten. Auch sonst trug das Lichtspielhaus die Bezeichnung Palast mit einiger Berechtigung. Es war ausgestattet mit Garderoben, Bars, Marmortreppen, einem Spiegelsaal und sogar einem Springbrunnen. George konnte sich noch an die Premiere des Blauen Engel mit Marlene Dietrich erinnern. Der Champagner, vielleicht war es auch nur Sekt, floss in Strömen. Der alte Gloria-Palast hatte den Krieg nicht überstanden. Der neue befand sich in einem schlichten Nachkriegsbau, der anstelle des zerbombten historischen Gebäudes errichtet worden war. Das neue Kino hatte zwar eine moderne Filmtechnik für CinemaScope-Filme, aber nichts mehr von dem Glamour seines Vorgängers.
In den Goldenen Zwanzigern war der Ku’damm eine Glitzerwelt der Illusionen. Aber wenn George zurückdachte, so war dieser Boulevard der Lebensfreude schon damals in Gefahr. Er erinnerte sich noch gut an den September 1931. Hunderte SA-Leute in Uniform oder in Zivil hatten sich unter die Passanten gemischt und griffen Juden an, die aus der Synagoge in der Fasanenstraße kamen. Dann wurden auch Passanten, die irgendwie jüdisch aussahen, beschimpft und geschlagen sowie jüdische Lokale und Restaurants verwüstet. Die Schlägertrupps hatten auch das Romanische Café, sein Stammlokal, heimgesucht. George hatte die SA-Trupps auf der Straße gesehen. Es war als hätte eine feindliche Armee das Viertel besetzt. Eva konnte ihn gerade noch zurückhalten, sich einzumischen. Er hörte noch, wie ein SA-Führer triumphierend rief: »Jetzt haben wir dem verjudeten Kurfürstendamm einen gehörigen Denkzettel verpasst!«
Viele der Passanten schienen durchaus mit der Aktion einverstanden zu sein, zumindest unternahm niemand etwas. Auch die Polizei ließ sich lange Zeit nicht blicken. Damals war George bewusst geworden, dass er Deutschland wohl bald verlassen müsste. Er konnte die Gefahr körperlich spüren. Hitler würde in diesem vom Krieg gedemütigten Deutschland bald an die Macht kommen. Diese Einsicht drängte sich ihm immer unerbittlicher auf. Als er dann das Angebot bekam, an einer amerikanischen Kunsthochschule zu unterrichten, hat er nicht lange gezögert. Zunächst ging er für einen Sommer allein nach New York, ein halbes Jahr später dann endgültig mit Eva und den beiden Söhnen. Er hatte Berlin gerade noch rechtzeitig vor Hitlers Machtergreifung verlassen können. Die Situation drohte gefährlich zu werden. Er wusste, dass er auf der Schwarzen Liste der Nazis stand. Schon einmal war er ihnen nur knapp entgangen. Betrunkene SA-Leute standen eines Abends vor seinem Atelier und brüllten: »Komm raus, du Judenschwein!«
Es hätte in dieser Situation wohl wenig genutzt, den Kameraden zu versichern, dass alle seine Vorfahren deutsche Bauern aus Hinterpommern waren. Als die Uniformierten drohten die Tür einzutreten, öffnete er ihnen schließlich: »Es tut mir leid meine Herren, aber der Herr Künstler ist leider die ganze Woche verreist und kommt erst am nächsten Montag wieder. Ich mache hier nur sauber. Kann ich etwas ausrichten?«
Wie immer bei der Arbeit trug George eine alte Kittelschürze und ein Stoffkäppi, ein Aufzug, in dem er ziemlich lächerlich aussah. Seine Unschuldsmine und ein aufgesetzter pommerscher Akzent taten ein Übriges. Die SA-Rabauken waren offensichtlich verdutzt und standen einen Augenblick unschlüssig herum. Dann brüllte der Anführer: »Du kannst dem Schmierfinken sagen, dass wir wiederkommen und ihm seine Judenfresse polieren werden, wenn er nicht verschwindet. Heil Hitler!« Darauf zogen sie ab.
Читать дальше