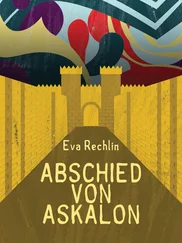Joachim Burdack
Abschied von der Wielandstraße
Als der Beat nach Berlin kam und die Studenten auf die Straße gingen
Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis
Titel Joachim Burdack Abschied von der Wielandstraße Als der Beat nach Berlin kam und die Studenten auf die Straße gingen Dieses ebook wurde erstellt bei
Prolog
1. Gloria im Fuchsbau
2. No Satisfaction in der Waldbühne
3. Jules und Jim und Sylvie und Albert
4. Johnny, der Manager
5. Hanau Blues
6. Sylvie und Albert vor der Ehrentribüne
7. San Francisco im Riverboat
8. Mit Farah Diba vor der Oper
Intermezzo: Der Schütze im Schleusenkrug
9. Ein Abend im Twistkeller
10. Mit Paula in der Mokka-Milch-Eisbar
11. Rüdiger erklärt die Zukunft Berlins im Wirtshaus Wuppke
12. Paula im Morgengrauen in Michendorf
13. Die Geschichte einer Winternacht
14. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern
15. Sylvie, Albert und Paris im Mai
16. Albert besucht die Wielandkommune
17. Zoff mit Zappa im Sportpalast
Epilog
Literatur und Quellen (Auswahl)
Impressum neobooks
Mitte der 60er Jahre brach in Berlin ein bisher unbekannter Virus aus. Er verbreitete sich rasch und befiel weite Teile der Jugend. Mit Befremden registrierten ältere Berliner die plötzlich auftretenden Symptome der Krankheit bei Teenagern: wildes Gekreische, Schüttelanfälle, Tanzen bis zur Erschöpfung, lautes Radiohören, zwanghafter Schallplattenkauf. Erst später gab man der Epidemie einen Namen: Beatlemania .
Derartige Ausbrüche von Tanzwut kannte man in Mitteleuropa eigentlich nur aus alten Chroniken. Quellen aus dem 15. und 16. Jahrhundert berichten von sogenannten Veitstänzen. Besessene tanzten damals tagelang, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen. Der Ursprung der Tanzwut blieb rätselhaft. Historiker vermuten, dass der Wahn durch den Verzehr von Mutterkorn hervorgerufen wurde. Im Brotteig hatte sich eine halluzinogene Substanz gebildet.
Der Ursprung der Beatlemania ist dagegen eindeutig bestimmbar. Den Infektionsherd bildeten vier Musiker aus der englischen Hafenstadt Liverpool: John, Paul, George und Ringo. Sie verbreiteten den Erreger hauptsächlich über Radiosender und Schallplattenläden.
Die Hoffnung der Erwachsenen, das Fieber würde genauso schnell wieder abklingen, wie es gekommen war, erfüllte sich nicht. Es wurde sogar noch schlimmer: Eine hartnäckige Mutation des Virus trat auf. Die Neuinfizierten wollten nicht nur Beatmusik hören, sondern selbst welche machen. Bald kam der Lärm nicht nur aus den Radios und Musikboxen, sondern selbsterzeugt aus Kellern und Schuppen.
Anstatt mit ihren Kumpels eine Bande zu bilden, gründeten viele Jungs jetzt eine Beatband. Was Jugendämter und Sozialarbeiter nicht geschafft hatten, nämlich die Jugend von der Straße zu holen, gelang der Beatmusik. Statt mit Kofferradios an Straßenecken herumzulungern, Mädchen nachzupfeifen und sich mit Banden aus dem Nachbarkiez anzulegen, verzog man sich nun in Kellerräume, um dort ungestört Lärm zu machen.
Einer der Jugendlichen, die es besonders schlimm erwischt hatte, war Ricky aus der Wielandstraße in Charlottenburg. Er träumte von einer Karriere als Beatmusiker. Ricky hieß eigentlich Richard. So stand es in seinem Ausweis: Richard Herzog. Aber er mochte seinen Vornamen nicht. Zwar hieß auch einer der Beatles Richard, aber der stand mit seinem Namen offenbar auch auf Kriegsfuß und nannte sich lieber Ringo . Richard Herzog beschloss, sich fortan Ricky zu nennen .
Albert Bergmann, Rickys Cousin, kennen Leserinnen und Leser von Letzte Tage am Savignyplatz bereits. Die Mütter der beiden jungen Männer sind Schwestern. Die Familien Bergmann und Herzog wohnen nur wenige hundert Meter voneinander entfernt: die Bergmanns in der Mommsenstraße und die Herzogs am nördlichen Ende der Wielandstraße.
Albert studiert inzwischen an der Freien Universität. Auch dort gärt es. Man protestiert gegen die alte Universität der Ordinarien - den Muff von tausend Jahren unter den Talaren - und gegen den neuen Krieg der Amerikaner in Vietnam.
Irgendwann fiel Ricky hier ein Zusammenhang auf. Das Abspielen einer Beat-Platte und ein Spruch wie Amis raus aus Vietnam lösten bei seinem Vater und anderen Erwachsenen die gleichen wütenden Reaktionen aus. Hatte beides vielleicht etwas miteinander zu tun? War beides Ausdruck eines Protests gegen die Welt der Erwachsenen?
Winter 1964/65
Alles fing an, als Ricky - siebzehn Jahre alt, durchschnittliche Größe, unauffälliges Aussehen - zufällig Peter auf der Straße wiedertraf. Die beiden waren eine Zeitlang Klassenkameraden gewesen, aber Peter hatte das Gymnasium nach der zehnten Klasse verlassen. Beide verband eine Leidenschaft für die Musik. Während ihrer gemeinsamen Schulzeit hatten sie zusammen in einer Skiffle Band gespielt, den Skiffle Foxes. Peter war damals der Einzige in der Gruppe, der ein richtiges Instrument hatte. Er spielte Gitarre. Ricky sang und war außerdem Kazoo-Spieler, eine Art Kammbläser. Außerdem gab es noch ein Waschbrett und einen Teekistenbass.
Die Skiffle Foxes brachten es auf insgesamt zwei öffentliche Auftritte. Den ersten hatten sie beim Geburtstag einer Mitschülerin. Das zweite und finale Gastspiel der Foxes erfolgte bei der Vorrunde des Berliner Skiffle Band-Wettbewerbs um das Goldene Waschbrett . Jede Gruppe hatte zehn Minuten Spielzeit; das reichte gerade für drei Stücke. Die Skiffle Foxes waren als zehnte Band an der Reihe. Der Ansager verkündete:
»Wir machen dann weiter mit den Skiffle Foxes, wenn sie nicht inzwischen im Hühnerstall verschwunden sind. Ah, da kommen sie ja schon!«
Die vier Füchse stiegen mit ihren Instrumenten auf die Bühne und stellten sich im Halbkreis um das Mikrofon. Das erste Stück spielten sie vor lauter Aufregung viel zu schnell. Das zweite Stück, Ice Cream , klappte dann besser. Das Publikum spendete freundlichen Applaus. Ricky hatte sich inzwischen an die hellen Scheinwerfer gewöhnt. Er war jetzt viel entspannter. Zum Abschluss sollte er, als Höhepunkt des Auftritts, seine Imitation von Louis Armstrongs Reibeisenstimme darbieten. Ricky presste seine Stimmbänder zusammen, um den gutturalen Klang von Satchmos Stimme nachzuahmen. Heute gelang es ihm richtig gut. Immer mehr steigerte er sich in den Gesang hinein. Dann, kurz vor Ende der zweiten Strophe von When the Saints go marchin‘ in, merkte er, dass er keinen Ton mehr herausbrachte. Offensichtlich hatte er seine Stimmbänder überanstrengt. Ricky deutete auf seinen Hals und gestikulierte wild. Seine Bandkollegen begriffen nicht was los war. Ratlos spielten die Foxes noch eine Weile weiter, dann hörten sie auf. Ricky wollte etwas sagen, hatte aber keine Stimme mehr.
»Danke an die Skiffle Foxes, dass sie sich so kurz gefasst haben«, verabschiedete sie der Ansager. »Vielleicht hat ja jemand im Publikum einen Salbeibonbon für unseren Satchmo von der Spree. Kopf hoch, Jungs, es kann nur noch besser werden!«
Bei den Skiffle Foxes lief nach dem missglückten Auftritt nicht mehr viel zusammen. Die eine Hälfte der Band wollte deutsche Schlager ins Programm aufnehmen, zum Beispiel Da sprach der alte Häuptling der Indianer oder Der Mann im Mond von Gus Backus. Die Lieder würden Stimmung bringen, da könnten alle mitsingen. Ricky und Peter lehnten das ab. Deutsche Schlager hatten nichts mehr mit Skiffle zu tun. Die Fronten waren verhärtet. Bei Prinzipienfragen gab es keine Kompromisse. Jedes Nachgeben wäre ehrloser Verrat an der eigenen musikalischen Überzeugung. Peter und Ricky packten ihre Sachen und verließen den Übungsraum und die Skiffle Foxes.
Читать дальше