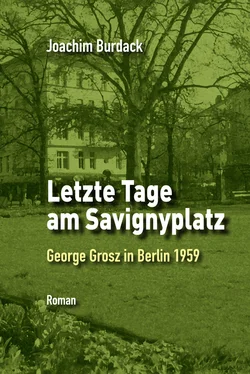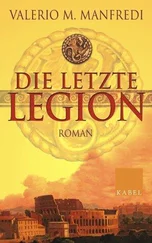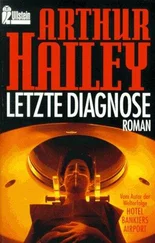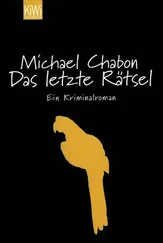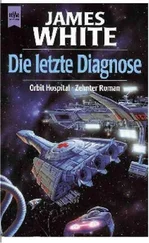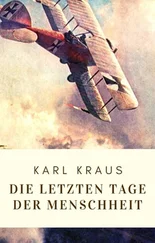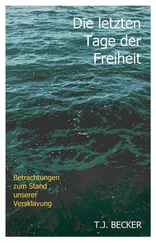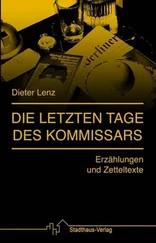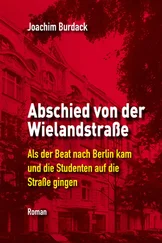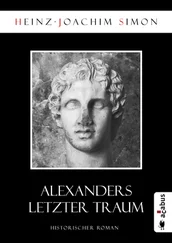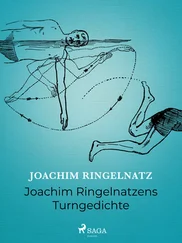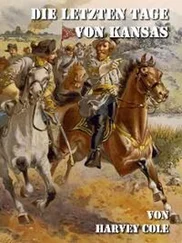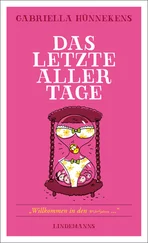Doch was war in dieser Nacht wirklich geschehen?
1. George zurück am Kurfürstendamm
15.Juni 1959
» Ach knallige Welt du Lunapark, du seliges Abnormitätenkabinett. Paß auf! Hier kommt Grosz, der traurigste Mensch in Europa. Ein Phänomen an Trauer « , murmelte der groß gewachsene, ältere Herr vor sich hin. Er zitierte gerne aus seinem Gesang an die Welt , wenn er nachdenklich gestimmt war. Zum wiederholten Mal hatte er bei seinem Spaziergang einem Haufen Hundekot ausweichen müssen, der mitten auf dem breiten Bürgersteig in Charlottenburg lag. Berlin hatte sich verändert, seit er die Stadt vor einem Vierteljahrhundert verlassen hatte, in jeder Hinsicht.
Das wolkenverhangene, trübe Wetter an diesem Junitag drückte auf Georges Stimmung. In New York war es um diese Jahreszeit oft schon heiß und schwül, das war natürlich auch nicht besser. Man hätte ihn mit seinem breitkrempigen Hut und der gestreiften Krawatte leicht für einen amerikanischen Touristen halten können. Sobald er jedoch sprach, belehrte sein akzentfreies Deutsch eines Besseren. Vor drei Wochen waren er und seine Frau Eva in Amerika aufgebrochen, hatten sich in New York auf der Bremen nach Bremerhaven eingeschifft. In Deutschland verbrachten sie zunächst ein paar Tage in Hamburg. Dann ging es mit dem Flugzeug weiter nach Berlin. Hier wohnten sie nun vorübergehend, bis sie eine passende Bleibe gefunden hatten, in der Wohnung von Evas Schwester Lotte am Savignyplatz. Die Akademie der Künste in West-Berlin, die George zu ihrem Mitglied gewählt hatte, half ihnen bei der Wohnungssuche, aber noch war nichts Geeignetes in Aussicht. Eva und Lotte waren unterdessen in den Harz gereist. Dort trafen sie sich mit ihrer Mutter. George hatte die Wohnung für sich und endlich auch etwas Zeit, sich in Berlin umzuschauen.
Vom Savignyplatz kommend, war er in die S-Bahn-Passage eingebogen, die zur Bleibtreustraße führte. Dort schwenkte er nach links und ging unter dem Bahn-Viadukt in Richtung Kurfürstendamm. Über ihm ratterte ein Zug mit ohrenbetäubendem Lärm. ‚ Turbulente D-Züge über rasselnde Brücken knatternd ‘, fiel ihm dazu aus seinem Gesang ein. Die Tauben, die sich in den Querstreben der eisernen Brücke angesiedelt hatten, schien der Lärm nicht zu stören. Sie gurrten weiter vor sich hin und bedeckten die Brückenpfeiler geduldig mit einer hellen Dreckschicht. Wenn George je wieder Bilder von Berlin malen sollte, wären sie wohl voller Hundekot und Taubendreck. Das ließe sich gar nicht vermeiden. Die Exkremente waren ihm aufgefallen und würden sich somit ins Bild drängen, einfach durch den Eindruck, den sie bei ihm hinterlassen hatten. Eigentlich hatte er immer nur Bilder voller Schönheit malen wollen, als er als junger Maler frisch von der Dresdner Akademie zurück nach Berlin kam. Aber die Wirklichkeit, die er wahrnahm, ließ das nicht zu. Immer wieder fiel sie ihm in den Pinsel. Wie sollte man Schönes malen, wenn man nur Hässliches und Gewalttätiges um sich herum sah? Berlin hatte ihn einfach überwältigt. Zeichnen wurde für ihn in jener Zeit eine physische und psychische Notwendigkeit, ein Akt der Selbsterhaltung, eine Art rituelle Reinigung. All die Dämonen, die auf ihn eindrangen, mussten raus aus seinem Kopf und auf Papier oder Leinwand gebannt werden: die Schieber und die Schupos, Huren und Zuhälter, Kriegsinvaliden und Kriegsgewinnler, Spartakisten und die Freikorpsmänner.
George war zwar in Berlin geboren, aber heimisch hatte er sich hier nie gefühlt. Heimat, das waren für ihn eher die Kleinstadt Stolp und die Landschaft an der pommerschen Ostseeküste. Als Junge hatte er dort tagsüber in den Wäldern und Dünen gespielt und abends Abenteuer- und Wildwestromane verschlungen. Im Rückblick erschien ihm diese unbeschwerte Kindheit als die glücklichste Zeit in seinem Leben. Aber im idyllischen Pommern hätte er nie die Bilder malen können, die ihn in den zwanziger Jahren berühmt und - wie manche behaupten würden - auch berüchtigt gemacht hatten. Seine Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder waren voller Gewalt und menschlicher Perversion.
Eine Art Hassliebe verband ihn mit Berlin. Er benötigte die Stadt als Inspiration für seine Werke. Aber gleichzeitig brachte ihn die ständige Reizüberflutung aus dem emotionalen Gleichgewicht. Der großstädtische Moloch ging ihm auf die Nerven, machte ihn aggressiv und wütend. Es gab zu viele Menschen auf engem Raum, zu viel Rücksichtslosigkeit und endloses Elend. Berlin nagte regelrecht an ihm. Depressionen wurden seine ständigen Begleiter. Manchmal meinte George, einen perfiden Mechanismus des Kunstbetriebs zu erkennen. Je schlechter es ihm persönlich ging, desto mehr Erfolg hatte er als Maler. Das Publikum mochte es anscheinend, wenn ein Künstler von seinem Werk verschlungen wurde, wenn er sich dafür ans Kreuz schlagen ließ oder sich wenigstens ein Ohr abschnitt. Das Opfer der geistigen und körperlichen Gesundheit auf dem Altar der Kunst galt als Beleg von Wahrhaftigkeit und Authentizität.
Wenn er den Moloch nicht mehr aushielt, reiste er mit Eva nach Frankreich. Dort fand er Ruhe. Die Bilder, die er von dort mitbrachte, waren ganz anders gestimmt als seine Berliner Werke. Gleichsam als ob eine andere Person sie geschaffen hätte. Im Scherz sagte Eva manchmal, dass er wie Doktor Jekyll und Mr. Hide malen würde. Der aggressive und aufgewühlte Mr. Hide führe seinen Stift in Berlin, während der freundliche Doktor Jekyll sich in Südfrankreich seiner annahm.
Das alles war drei Jahrzehnte her. Nazizeit und Krieg hatte er in New York verbracht. Gerade noch rechtzeitig vor Hitlers Machtübernahme war er mit seiner Familie nach Amerika geflohen. Jetzt kam er als amerikanischer Staatsbürger zurück. Heute spürte er nichts mehr von seinen damaligen starken Emotionen. Das heutige Berlin des Jahres 1959 konnte er vielleicht bemitleiden, bedauern oder auch belächeln, aber starke Gefühle von Zuneigung oder Abneigung löste dieser geteilte Torso einer Metropole bei George nicht mehr aus. Berlin wirkte blasser auf ihn als früher, wie eine alte Postkarte, deren Farben ausgeblichen waren. Alles war banaler. Sogar die Latrinensprüche, die George immer gerne gelesen hatte, waren schlechter geworden. Früher konnte man kleine Kunstwerke auf den öffentlichen Toiletten entdecken. Einige waren sogar Inspiration für seine Zeichnungen. Heute fanden sich dort meist nur primitive Kritzeleien, Telefonnummern und das Wort ficken in allen Konjugationsformen. George war der Meinung, dass man den Zustand einer Kultur auch an ihren Toilettensprüchen ablesen konnte. Wenn das stimmte, dann bestand hier wenig Hoffnung.
Er wunderte sich auch, wie wenige Kriegsinvaliden man auf den Straßen sah. Das war nach dem Ersten Weltkrieg ganz anders gewesen. In jedem Hinterhof schienen damals einarmige Leierkastenspieler ihre Drehorgeln zu betätigen. An jeder Ecke saßen Uniformierte mit Beinstümpfen und verkauften Streichhölzer. Wo waren die Verstümmelten des letzten Krieges verblieben? Auf den Straßen sah man sie jedenfalls nicht. Dafür fielen die vielen älteren Frauen im Straßenbild auf. Waren es Kriegswitwen, deren Männer in Russland gefallen waren oder versteckten sie ihre Krüppel von Ehemännern einfach zu Hause?
Nur den Hunden schien es in Berlin gutzugehen. Ihre Zahl hatte jedenfalls stark zugenommen. So ließe sich das kriegsversehrte Berlin eventuell auf die Leinwand bringen: Eine alte Frau mit einem Dackel, der seinen Haufen auf dem Trottoir platziert. Vielleicht sollte er sich einen Skizzenblock besorgen.
In der Bleibtreustraße konnte er das ihm vertraute Vorkriegs-Berlin noch eher wiedererkennen als in großen Teilen der Innenstadt. Die Kriegsschäden hatten sich hier offensichtlich in Grenzen gehalten. Total zerstört waren nur die beiden Eckhäuser an der Niebuhrstraße. An einer Ecke hatte man die Ruine abgeräumt und einen schmucklosen Flachbau für ein Kino errichtet. Capri verkündete die neonfarbige Leuchtschrift über dem Eingang, ein trauriges Symbol deutscher Sehnsucht nach dem Süden. Im gegenüberliegenden Ruinengebäude wurde nur noch das Erdgeschoss von einem kleinen Schreibwarengeschäft genutzt. Hier konnte er nach Skizzenpapier fragen. Vielleicht verspürte er ja Lust, ein paar Zeichnungen anzufertigen. Er betrat das Schreibwarengeschäft und wählte einen der Skizzenblöcke aus, den die nette Verkäuferin ihm vorgelegt hatte. In der hinteren Ecke des Ladens saß ein kleiner Junge konzentriert über ein Schreibheft gebeugt. Er erledigte offensichtlich seine Schularbeiten. Vor ihm stand eine halbvolle Flasche Sinalco. George kaufte noch eine Ansichtskarte. Später verschickte er die Karte mit folgendem Text: Schön in Berlin, sehr grün und still. Viele alte Frauen mit Stöcken. Almost like a resort, wie ein Kurort hier.
Читать дальше