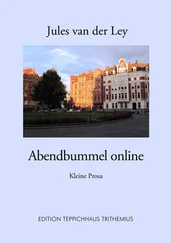Am Nachmittag nahm ich den Brief mit auf eine Radtour und fuhr ihn ein bisschen durch niederländische Grenzorte spazieren. Auf dem Rückweg wollte ich ihn bei der Post im Aachener Vorort Kohlscheid loswerden. Die Filiale war dicht. Ihre Aufgaben erledigt man jetzt in einem Schreibwarenladen. Dort stand ich eine Viertelstunde auf den aufgemalten Füßen der Distanzzone, denn die beiden Angestellten verzweifelten über den apodiktischen Forderungen des Postcomputers. Irgendwann drücken sie eher zufällig die richtigen Tasten, und die Schlange hinter mir seufzt erleichtert. Die Kundin ist bedient. Es geht doch nichts über gut ausgebildetes Personal. Die Briefmarke kriege ich zackzack. Die Frauen hinterm Tresen sind mir hold, denn eine Marke von der Rolle zu reißen, sie auf einem roten Schwämmchen zu feuchten und dann zu wetteifern, wer sie auf den Brief kleben darf, das hat ein bisschen was von Kinderpost.
Diese an sich unerheblichen Begebenheiten schildere ich nur, um den Ausnahmefehler im galaktischen Betriebssystem zu beweisen. Denn man wird zugeben müssen, dass all die kleinen Begebenheiten und Imponderabilien in der Summe unwägbar sind, was ihren Zeitbedarf betrifft. Daher ist es völlig unwahrscheinlich, was geschah, als ich um sechs Uhr erneut am Hauptgebäude der Technischen Hochschule vorbeifuhr: Auf dem Bürgersteig kam mir eine große Gruppe gleichkleiner Chinesen in dunklen Anzügen entgegen. Sie strebten in Marschordnung dem Hauptgebäude zu. Etwa in der fünften Reihe ragte eine Frau hervor. Sie trug ein ockerfarbenes Jackett und wirkte zwischen den dunklen Herren wie ein mitgeführtes Banner. Ich passierte sie genau an der Ecke des Reiffmuseums.
Es sah aus, als wären die Chinesen und ihr Banner heute zwischen zwölf und sechs Uhr nicht von der Stelle gekommen, obwohl sie so zielstrebig ausschritten. Sie selbst schienen davon nicht zu bemerken; sie wirkten eifrig und entschlossen wie zuvor.“
Coster schob die Tasse von sich und sagte: „Das war aber ein langer Bericht.“
Am Nebentisch schoben sich vier junge Frauen in ihre Mäntel und strebten an der Theke vorbei dem Ausgang zu. Der Thekenkellner kam in den Gang, küsste jede von ihnen auf die Wange und rief ihnen hinterher: „Tschüs ihr Süßen!“ Auch Coster hatte sich erhoben und ich folgte ihm. Als wir an der Theke vorbeigingen, winkte uns der Thekenkellner neckisch zu und rief erneut: „Tschüß, ihr Süßen!“ Das jedenfalls war kein schwerer Ausnahmefehler im galaktischen Betriebssystem. Der Thekenkellner hatte sich schlicht vertan, weil in dem hübschen Altstadtcafé die Schwulen- und Lesbenszene verkehrt. Coster war des Kellners Irrtum ein bisschen peinlich. Aber als wir auf die Gasse getreten waren, mussten wir sehr lachen.
Bericht von einer pataphysikalischen Forschungsreise
Wenn man in einer Stadt zu Hause war, nach einer Weile dahin zurückkehrt und sich wieder zu Hause fühlt, dann ist es ganz absonderlich, wieder zu Hause anzukommen. So wirr wie dieser Satz war mir der Kopf, als ich gestern Abend im Hauptbahnhof von Hannover eintraf. Es war wie ein bizarrer Traum, den man lieber nicht haben möchte, so als wäre man in die Fremde verschlagen worden, ins Ausland, worin etymologisch das Wort Elend steckt. Unsere Vorfahren haben nämlich gedacht, die Leute im Ausland hätten nichts zu essen.
Ich hatte einmal eine Schwiegermutter, die diese uralte Vorstellung treulich bewahrte. Sie war nicht vom Gegenteil zu überzeugen gewesen, bis ich sie einmal in Aachen in den Zug geschubst und ins Ausland verschickt habe. Der Zug fuhr statt nach Köln nach Brüssel. Es war keine böse Absicht gewesen. Wir waren zu spät am Bahnhof angekommen, und ich war froh gewesen, dass der Zug noch da stand. Freilich entpuppte der sich nach dem Anrollen als der Zug in Gegenrichtung und riss zu meinem Entsetzen die gute Schwiegermutter nach Belgien davon.
Um sie vor einer langen, schrecklichen Fahrt ins tiefe Elend zu bewahren, rief ich im wallonischen Bahnhof Welkenraedt an. Bahnbeamte holten sie dort aus dem Zug. Meine Schwiegermutter sollte sich noch Jahre tief beeindruckt zeigen, erstens von den prächtigen Uniformen belgischer Bahnbeamter, dann von der sprachlichen Eleganz und ausgesuchten Höflichkeit. Sie redeten meine Schwiegermutter nämlich an mit: „Madame in Schwarz“.
Madame in Schwarz wollte natürlich ein Andenken an ihre Irrfahrt. In der Bahnhofshalle von Welkenraedt hing ein verstaubter Schaukasten mit belgischen Biergläsern. „Madame“ gab nicht eher Ruhe, bis einer der Bahnbeamten den Schlüssel für den Schaukasten besorgte und ihr ein Bierglas übergab, wofür er sich selbstverständlich weigerte, Geld anzunehmen. Diese generöse Tat war allerdings mit langer Wartezeit auf den Vitrinenschlüssel verbunden gewesen. Es handelte sich schließlich um einen Verwaltungsakt der Staatlich Belgischen Eisenbahngesellschaft. Da müssen Formulare in allen drei belgischen Amtsprachen ausgefüllt werden, und es ist die Genehmigung von höherer Stelle erforderlich, dass der belgische König die Dokumente zur Übergabe eines verstaubten Bierglases aus dem Bahnhof Welkenraedt an eine deutsche Madame in Schwarz nicht siegeln muss. Dank der beherzten Entscheidung des Bahnvorstands, den belgischen König außen vor zu lassen, konnten die Welkenraedter Bahnbeamten meine Schwiegermutter und ihr Bierglas rechtzeitig und würdevoll zum Gegenzug nach Köln geleiten. Das alles war für meine Schwiegermutter der Beweis, dass Ausland nicht gleich Elend sein muss. Es geht doch nichts über eigene Anschauung. Sie erst erweitert den Horizont.
Fast wäre es mir bei der Rückkehr aus Aachen lieber gewesen, so etwas wie den verwaisten Bahnhof von Welkenraedt vorzufinden, mit Lichtern, die für niemanden leuchten. Denn im lichterfunkelnden Hauptbahnhof von Hannover war ein unmenschliches Gerenne und Geschubse, dass ich mich kaum traute, den Koffer abzusetzen, um den Rollgriff auszufahren. Ich suchte eine stille Ecke auf, damit ich nicht mitgerissen wurde, hinaus in die Fremde. Und wäre die Menschenwoge verebbt, würde zurückweichen, dann fände ich mich am Ende in der furchtbarsten Einöde wieder. Kalt und finster wäre es. Dann würde in der Ferne das einzige Licht eines einsamen Hauses verlöschen, und ich wüsste nicht wohin …
Nirgendwo unter Tausenden Menschen ein vertrautes Gesicht zu sehen, ist auch nicht viel anders. Immerhin wusste ich wohin. Ach, und auf dem U-Bahnsteig grölten Fußballfans lauthals ihre Lieder, die wie eine versunkene Sprache aus der Steinzeit klangen. Wie gerne wäre ich vor sie hingetreten und hätte gesagt: „Ihr wirkt unsagbar doof. Ihr seid ja wohl eine Horde von Sturzblöden. Hoffentlich seid ihr nicht von hier und fahrt zurück in eure elende Heimat, obwohl ich glaube, dass keine hannöversche U-Bahn jemals solch verderbte Orte überhaupt anfährt, wo alle nur Inzucht betreiben. Wo Bruder, Schwester, Vater, Großvater, Tanten, Onkel und Schwippschwägerinnen – allesamt übereinander herfallen, nur eure Mütter nicht, weil sie es am liebsten mit Ziegenböcken treiben.“ Vermutlich hätte mich keiner von denen verstanden.
In der U-Bahn dann setzte sich eine junge, vollschlanke Türkin vor mich. Sie hatte ein unglaublich schönes Gesicht und in ihren großen Augen schimmerten Tränen. Ich konnte nicht umhin, immer wieder zu schauen, ob ihre Augen überlaufen würden, was aber nicht geschah. Sie hatte einen Knopf von ihrem Smartphone im Ohr, und mit einem Mal entschloss sie sich, jemanden anzurufen, „wo bist du?“ zu fragen und zu sagen: „Du bist in 10 Minuten an der Was-weiß-ich-Straße!“ Das duldete keinen Widerspruch. Da müsste schon einer ein steinernes Herz haben, nicht zeitig am besagten Ort einzutreffen. Aber solche mit steinernen Herzen gibt es zuhauf. In Großstädten wird man oftmals ungewollt Zeuge kleiner Tragödien, vor denen man ebenfalls das Herz verschließen muss, was insgesamt einen unsozialen Gewöhnungseffekt mit sich bringt. So ist der urbanisierte Mensch ein Gleichgültiger, und je größer eine Stadt, desto gleichgültiger die Bewohner.
Читать дальше