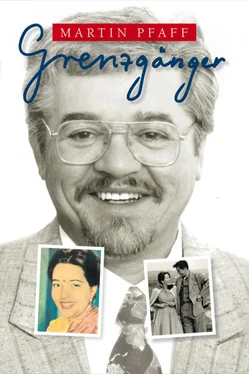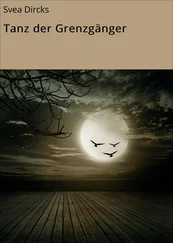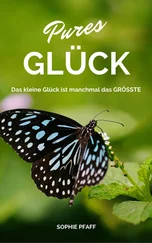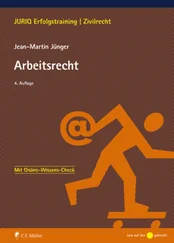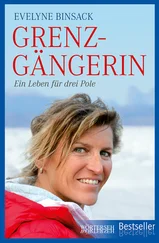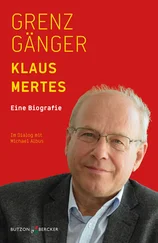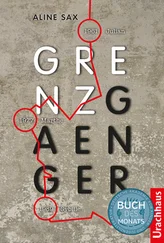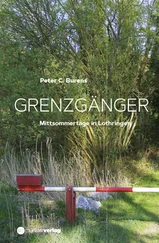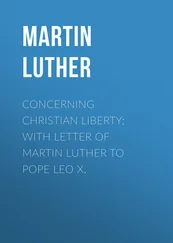1 ...6 7 8 10 11 12 ...32 Manchmal frage ich mich, ob das Verhalten der Russen und der Ungarn gegenüber den Donauschwaben das Maß dessen nicht weit überschritt, was man unter zivilisierten Völkern erwarten darf. Zweifelsohne hatten die Gräueltaten der Nazis während des Krieges den Hass auf alle Deutschen geschürt: Dafür mussten wohl die Deutschen büßen, derer man habhaft werden konnte – Flüchtlinge und Vertriebene, darunter auch die Donauschwaben. Obwohl die Donauschwaben seit Jahrhunderten in Ungarn angesiedelt waren. Sie waren ungarische Staatsbürger, leisteten Militärdienst und erfüllten ihre staatsbürgerlichen Pflichten. Woher kam also die Legitimation, sie aus ihren Häusern zu vertreiben und ins ferne Deutschland zu schicken? Hatten die Donauschwaben dazu beigetragen, weil sie sich nicht völlig in die ungarische Gesellschaft integrieren ließen?
3. Österreich: Die Suche nach dem Selbst
(1947 bis 1957)
Heute weiß ich, dass Wien zu den schönsten Städten Europas zählt, doch meine Eindrücke vom Wien des Jahres 1947 waren deprimierend. In Budapest war ich ganz aufgeregt gewesen, mit meinem so lange entbehrten Vater die attraktiven Seiten der Stadt zu erleben – den Blick von der Fischerbastei, das Parlament, die Kettenbrücke, den Zoo …
In Wien kamen wir dagegen in den 20. Bezirk, der zur russischen Besatzungszone zählte, in die Karl-Meißl-Straße, eine Zugangsstraße zum Augarten. Bei dessen Eingang befand sich eine dunkelgraue Verteidigungsanlage aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Fassaden der Häuser waren über Jahre vernachlässigt worden, es gab Bombenruinen und Lücken.
Mein Vater war meist längere Zeit abwesend, was meine Stimmung gewaltig drückte. Wien sah ich grau in grau, ähnlich wie die osteuropäischen Hauptstädte, die ich im späteren Leben während der Zeit der kommunistischen Herrschaft besuchte. In Tevel, später auf der Czárda und in Högyész, hatten wir Kinder neben den Pflichtaufgaben viel Freiheit genossen: Wir streiften umher, suchten Taubennester oder verfolgten das Treiben der Vögel.
Im Wien der Nachkriegszeit war an solche Freiheiten für einen Siebenjährigen nicht zu denken – dafür fehlte mir die Erfahrung mit der Großstadt, und dafür machten sich die Erwachsenen viel zu große Sorgen.
Franzi-Tante und Onkluschka hätten liebevoller und aufmerksamer nicht sein können. Franzi-Tante nahm mich zum Einkaufen und zu Besuchen bei Freunden mit. Ihre Familie stammte aus Kärnten, und ihre dunklen Haare, die dunklen Augen und die fein gezeichneten Gesichtszüge ließen ein römisches Erbe vermuten. Ihre kleine, zierliche Gestalt verstärkte diesen Eindruck.
Onkluschka – den Spitznamen gab ich ihm in Anlehnung an seine tschechische Abstammung – war hochgewachsen, mit einem lachenden, freundlichen Gesicht und einer hohen „Denkerstirn“. Er spielte Gitarre und sang dazu. Er war ein guter Zeichner und hat mich inspiriert, Interesse am Zeichnen und Malen sowie an der bildenden Kunst zu entwickeln.
Franzi-Tante und Onkluschka nahmen mich mit auf einen Demonstrationszug, der über den Ring verlief, vorbei am Parlament, am Wiener Rathaus, am Burgtheater … Meine Aufmerksamkeit galt den vielen roten Fahnen: „Onkluschka, wofür stehen die Buchstaben SPÖ auf den Fahnen?“
„Sie stehen für Sozialistische Partei Österreichs – abgekürzt SPÖ!“
„Wofür ist eine solche Partei gut?“
„Die SPÖ ist eine politische Partei, die aus der Arbeiterbewegung hervorgegangen ist. Deshalb hieß sie bis 1934 Sozialdemokratische Arbeiterpartei: Sie will die Ziele dieser Bewegung mit politischen Mitteln durchsetzen. Und sie hat dabei schon vieles erreicht.“
„Welche Ziele?“, fragte ich weiter.
„Die SPÖ will die Gegensätze zwischen Klassen, zwischen Arm und Reich überwinden. Sie will die Arbeit zwischen Männern und Frauen gerecht verteilen. Und sie will auch für eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen kämpfen. Und dabei will sie, dass die Menschen frei leben können!“
Eines Tages fragte ich nach der Bedeutung des 1. Mai und nach dem Wiener Bürgermeister. Onkluschka erzählte mir von der Arbeiterbewegung, dem Kampf gegen die Nazis und von der politischen Entwicklung Österreichs nach dem Krieg. „Eines Tages“, sagte er, „kannst du Bürgermeister von Wien werden – wenn du das nur wirklich willst und dafür zu arbeiten bereit bist!“ Ehrlich gesagt hatte ich kein Interesse daran, Bürgermeister von Wien zu werden. Aber die politischen Umwälzungen, von denen unsere Familie auf so dramatische Weise betroffen war, und die laufenden Ereignisse in Wien hatten mein Interesse geweckt.
Onkluschka wies mir den Weg zur Lektüre der Bücher von Karl May: Sie führten meine Gedanken hin zu fernen Ländern und Abenteuern. Winnetou und Old Shatterhand wurden meine Helden.
Mit der Oma hatte ich relativ wenig Kontakt. Dafür verstand ich mich sehr gut mit Traudl. Sie sollte meine – des Siebenjährigen – „erste Liebe“ sein. Eines Abends sagte ich zu ihr: „Wenn ich groß bin, hole ich dich in meinen Wigwam als meine Squaw!“ Traudl muss es wohl amüsiert haben, sie lächelte nur. Dafür wurde ich rasend vor Eifersucht, wenn ihre Verehrer aufkreuzten, um sie ins Kino einzuladen.
Ein besonderer Glücksfall für mein späteres Leben war ein junger Student. Da ich zwei Klassen Volksschule in ungarischer Sprache absolviert hatte und mein Vater mich in Wien in die 3. Klasse aufnehmen ließ, hatte ich Probleme mit dem Lesen und Schreiben auf Hochdeutsch. Mein schwäbischer Dialekt half mir zwar beim Verstehen, aber das war auch schon alles. Der Student erteilte mir Nachhilfestunden. Dabei ging es nicht nur um Deutsch und Rechnen, sondern auch um andere Fächer. Er beantwortete meine endlosen Fragen nach diesem oder jenem Gegenstand mit Geduld und großer Empathie. Dadurch konnte er mein Interesse am Lernen wecken, das in Ungarn sehr verkümmert war.
Als am Ende des Schuljahres die Zeugnisse verteilt wurden, war ich der beste Schüler meiner Klasse.
Die schulischen Erfolge setzten sich in der 4. Klasse fort. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass ich die Aufnahmeprüfung ins Internat der Schulbrüder in Strebersdorf nördlich von Wien ohne viel Mühe schaffte. Aus diesem „Elite-Gymnasium mit Internat“ waren viele Führungskräfte für Staat und Wirtschaft hervorgegangen. Wer weiß, was aus mir geworden wäre, wenn ich diesen Weg weitergegangen wäre.
Bevor die 1. Klasse Gymnasium begann, hatte mein Vater seine Schmugglertätigkeit beendet. Der Eiserne Vorhang war immer engmaschiger geworden. Es war nicht ungefährlich, bei Nacht durch die Felder zu kriechen oder den mittlerweile tatsächlich vorhandenen Grenzzaun zu überwinden. Einmal wurde mein Vater an der Grenze gefangen genommen, verhört und verprügelt, dann aber wieder freigelassen. Danach wollte er den illegalen Grenzübertritt nicht mehr riskieren.
Er fand Arbeit als Holzfäller in den Wäldern des Stifts Heiligenkreuz, einer Zisterzienserabtei im Herzen des Wienerwalds. Er mietete ein Zimmer in Alland nahe bei Heiligenkreuz. Es war deshalb naheliegend, mich lieber ins Internat des Stiftes Heiligenkreuz zu schicken. Das Stift hatte ein Gymnasium mit vier Klassen und ein angeschlossenes Internat. Unterrichtet wurde durch die Patres des Stifts, geprüft wurde am Ende des jeweiligen Schuljahres durch angereiste Professoren des öffentlichen Gymnasiums Baden bei Wien. So wurde ich ein Zisterzienserschüler.
„Ora et labora!“ - Bete und arbeite! Getreu ihrem Motto strebten die Zisterzienser eine Synthese von Beten und Handeln an. Die Entwicklungsgeschichte Europas, insbesondere auch Österreichs, ist wesentlich durch die zivilisatorische Tätigkeit der Zisterzienser geprägt: die Rodung der Wälder für den Ackerbau und die Pflege des Handwerks. Es verwundert nicht, dass das Stift Heiligenkreuz seit seiner Gründung im Jahr 1133 zu den Besitzern großer Ländereien zählte: Auch heute noch ist das Stift der zweitgrößte kirchliche Grundbesitzer Österreichs. „Armut“ war kein Merkmal des Ordens oder des Stifts Heiligenkreuz.
Читать дальше