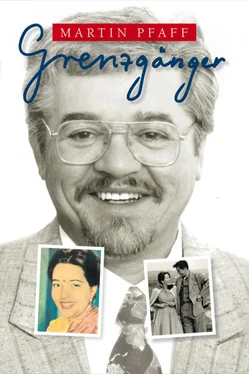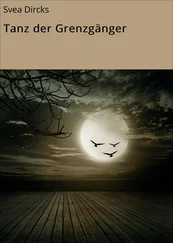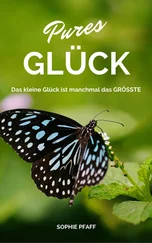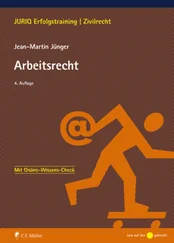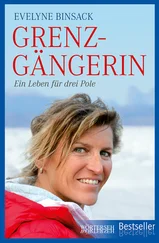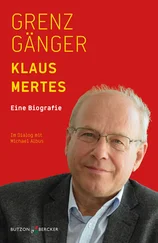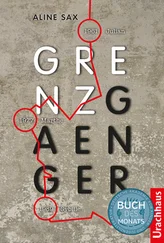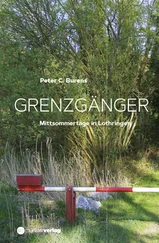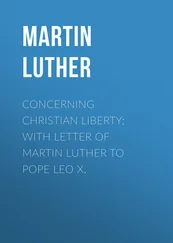Aus heutiger Sicht würde ich sagen: Sowohl die Donauschwaben als auch die Szekler waren Opfer und nicht Täter. Die Aussiedlungen hätten die Schwaben niemals freiwillig gewählt. Und die zugesiedelten Szekler wären wohl lieber in ihrer alten Heimat geblieben.
Die Leidensgeschichte unserer Familie war noch lange nicht zu Ende: Anfang 1947 wurde mein Onkel Mathias, zusammen mit der restlichen Familie, aus seinem Haus vertrieben. Wir kamen auf den Maierhof, ein Gutshof im nahe gelegenen Ort Högyész, in sehr viel ärmlichere Verhältnisse als bisher. Der Maierhof war eine typische Puszta – ein Gehöft für Landwirtschaft oder Viehzucht.
Zusammen mit meinem Bruder Matheis schlief ich in einem Bett. Als Unterlage diente Stroh. Bei Tageslicht konnten wir regelmäßig beobachten, wie Mäuse herumhuschten, wohl auf der Suche nach Nahrung.
Wir Kinder wurden zum Arbeiten eingesetzt: Wir hatten die Schafe zu hüten, gingen also regelmäßig auf die Weiden in der Umgebung von Högyész. Es waren auch einige größere Buben dabei. Eines Tages hörte ich das erbärmliche Geheul eines Hundes. Näher gekommen sah ich, dass die größeren Buben mit dicken Stöcken auf einen abgemagerten Hund einschlugen. Bei jedem Schlag stieß er ein markerschütterndes Jaulen aus. Blut floss von seinem Kopf und Nacken.
„Lasst den Hund in Ruhe! Er hat euch doch nichts getan!“, rief ich ihnen zu. „Du hast keine Ahnung – er ist räudig, und wenn er uns beißt, bekommen wir die Tollwut!“, war ihre Antwort. Ich lief davon, mein Gesicht nass von Tränen.
Auch später im Leben folgte ich instinktiv meinen Gefühlen, wenn es darum ging, den Schwächeren gegen den Stärkeren zu verteidigen. Erst in der Schule, dann im Internat, wo ich gezielte Strategien entwickelte, wie wir Schwächeren uns gegen die Stärkeren und Älteren durchsetzen konnten. Weglaufen wollte ich jedenfalls nie wieder – das hatte ich mir fest vorgenommen.
Ein anderer Vorfall hätte für mich böse Folgen haben können.
Eines Tages sah ich im Gras am Wegesrand ein metallenes Objekt, einer Konservendose ähnlich. „Hurra, damit können wir nach der Schule Fußball spielen!“, sagte ich zu Steffi und Johann und versteckte das Objekt in einem kleinen Busch, damit es bis zur Heimkehr aus der Schule keine anderen Liebhaber finden würde.
Am Heimweg fand ich die „Dose“ wieder und schickte mich an, damit zu spielen.
Ich lief einige Meter von meinen beiden Kusins weg, holte aus und warf das Objekt 20 Meter weit voraus, inmitten des Hohlweges.
Zunächst wurde ich wie von einer großen Faust brutal getroffen und rückwärts zu Boden geschleudert. Ganz benommen richtete ich mich auf: Im Weg klaffte ein beachtliches Loch. Ich blutete im Gesicht – am Augenlid – und am Bauch. Mir war schwindlig. Hätte mich der Splitter einige Millimeter tiefer getroffen, hätte ich wohl das Sehvermögen auf einem Auge verloren. Jahrzehnte später hat eine MRT-Untersuchung gezeigt, dass ein Metallsplitter bis heute in meiner Hirnrinde feststeckt.
Bei der Dose handelte es sich um eine ungarische Handgranate. Deren Form kannten wir nicht, im Gegensatz zu den deutschen Handgranaten, die neben dem Gehäuse auch einen Stiel zum Werfen hatten.
Auf dem weiteren Weg kamen wir zu einem Teich. Ich ging barfuß hinein, um mir das Blut vom Gesicht und vom Hemd zu waschen. Auf einmal drehte sich alles um mich herum. Mein Kusin Steffi führte mich aus dem Wasser heraus.
Ein weiterer Vorfall erschütterte mich noch viel mehr und traf mich bis ins Innerste: Mein Vater war mit seiner Einheit im Rheinland in amerikanische Gefangenschaft geraten.
Im August 1945 konnte er fliehen und arbeitete in einer Gärtnerei bei Köln. Im Frühjahr des folgenden Jahres machte er sich zusammen mit drei anderen Männern auf den Weg nach Hause. Einer dieser Männer kam aus dem grenznahen Ort Pusztasomorja (auf der österreichischen Seite liegt – wie erwähnt – Andau). Sie überquerten die Grenze zwischen Österreich und Ungarn bei Nacht.
Mein Vater reiste weiter, bis er in der Nähe von Tevel auf meinen Onkel Martin traf. Von ihm erfuhr er von der Verschleppung meiner Mutter nach Russland, von der Vertreibung … Martin warnte meinen Vater: „Die Heimkehrer sind nicht sicher. Die Gendarmen nehmen sie fest und schicken sie ins Arbeitslager nach Russland.“ Mein Onkel wäre verpflichtet gewesen, ihn bei der Polizei zu melden.
Meine Kusine Mari schilderte später seine damalige Situation: „Sie hätten deinen Vater sofort ins Lager gebracht und wie einen Kriegsverbrecher eingesperrt. Man hätte ihn nie in Tevel geduldet, denn es wurde unterstellt, dass er verantwortlich dafür war, dass sich so viele junge Männer 1940 und 1941 zur Waffen-SS gemeldet hatten und später in Russland umkamen. Es gab Gehässigkeiten zwischen den Pro-Deutschland- und Pro-Ungarn-Tevelern, die ja alle deutscher Abstammung waren. Auch deine Mutter hätten die Teveler nicht geduldet, wenn sie nicht nach Russland verschleppt worden wäre und somit auch ein Opfer gewesen wäre!“
Erst nach Einbruch der Dunkelheit sollte mein Vater – so der Rat meines Onkels – sich bei meinen Großeltern melden, damit er nicht gesehen würde.
Dennoch habe ich eine Erinnerung an einen heißen, schwülen Sommerabend. Die Erwachsenen schienen unter großer Anspannung zu stehen. Wir Kinder wussten nicht, warum. Sie schickten uns frühzeitig ins Bett. Ganz ungewohnt sperrten sie die Tür zum gemeinsamen Schlafzimmer zu.
Auf einmal horchte ich auf: War das nicht die Stimme meines Vaters, den ich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen oder gehört hatte? Ich rüttelte an der Tür, schlug mit Fäusten dagegen und rief: „Vater! Vater!“ Es fruchtete nichts. Die Tür blieb verschlossen. Schließlich gingen wir vier – Steffi, Johann, Matheis und ich (mein Bruder Toni war bei der Familie meines Onkels) – schlafen.
Am nächsten Morgen verhielten sich die Erwachsenen, als ob nichts gewesen wäre.
Mein Vater kehrte zurück zu seinem Bekannten in Pusztasomorja. Dieser regte an, dass er zwischen Wien und Pusztasomorja als Schmuggler tätig sein könnte, denn in Wien brauchte man Lebensmittel wie Speiseöl, Schinken und Würste. Dies musste von den Bauern im Weinviertel sowie in Ungarn eingetauscht werden. Dadurch hätte er Gelegenheit, von der ungarischen Seite Geld und Lebensmittel an die Familie auf der Czárda zu schicken. Und schließlich könne er auf diese Weise leichter erfahren, ob und wann seine Frau – meine Mutter – aus der russischen Gefangenschaft zurückkehren würde.
Für meinen Vater war dies ein ungewöhnlicher Vorschlag: Er war schon als Kind und Jugendlicher ob seines Wissensdrangs aufgefallen. Unter heutigen Bedingungen hätte er studiert und einen bürgerlichen Beruf ausgeübt.
Doch er entschloss sich, die Schmugglertätigkeit auszuüben – mit bescheidenem Erfolg. Durch diese Tätigkeit lernte er die im 20. Bezirk Wiens lebende Familie Franz und Franziska Logotka kennen. Und zu ihnen holte er mich (kurz vor Ende meines zweiten Schuljahres) nach Wien. Die „Franzi-Tante“ und der „Onkluschka“ wurden zu meinen Ersatzeltern. Bei ihnen fand ich Wärme und Geborgenheit. Zusammen mit ihrer sechzehnjährigen Tochter Traudl und der Oma lebten wir in einer mittelgroßen Wohnung. Meinen Vater sah ich nur, wenn er von seinen Schmuggelgängen zurückkam.
Bei seinem letzten Besuch in Ungarn erfuhr er, was mit den verbliebenen Familienmitgliedern geschehen war:
Anfang 1947 musste auch sein Bruder mit dem Rest der Familie das Haus verlassen. Sie kamen auf den Gutshof nach Högyész. Am 16. März 1948 wurden dann die Teveler, sowohl die Volksbündler als auch die Mitglieder der Treuebewegung, in Szakály-Högyész in Viehwaggons gesteckt und in die in Ostzone Deutschlands verfrachtet. Sie kamen in Pirna bei Dresden ins Lager.
Wenn ich diese Ereignisse Revue passieren lasse, bewundere ich die Charakterstärke der Teveler und die meines Vaters: Zweifelsohne hatte es viel Mut erfordert, in die Umgebung Tevels, geschweige denn nach Tevel selbst, zurückzukommen. Ich kann diesen Mut nur bewundern.
Читать дальше