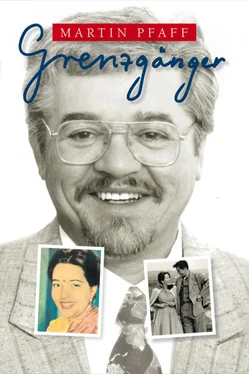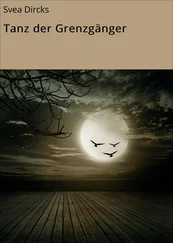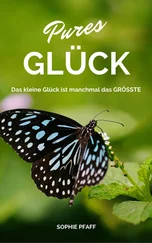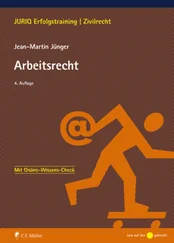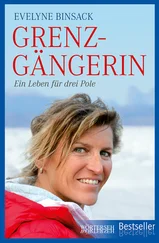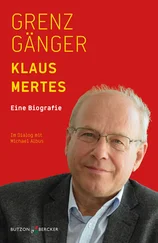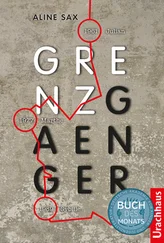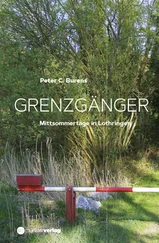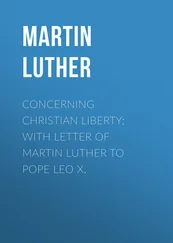1 ...7 8 9 11 12 13 ...32 Meine Jahre im Zisterzienserkloster haben es mir – bei all dem Positiven – eher erschwert, vorgegebene Grenzen zu überwinden. Hierfür musste ich eine persönliche „Revolte“ in Fragen der Religion durchführen. Aber dazu später mehr.
Man kann nicht im Stift Heiligenkreuz leben, ohne von der Aura und dem Ambiente dieses Klosters geprägt zu werden, ohne Augen und Gefühle für die Kunst zu öffnen und ohne für den Rest des Lebens offen zu sein für Fragen der Spiritualität und der Religion.
Wenn man das Stift durch einen der Torbögen betritt, öffnet sich der Blick auf einen großen Hof. Ein weiterer Torbogen führt in den eigentlichen Innenhof mit Zugang zur wunderschönen Stiftskirche, zur Pforte, dem Tor zum Kreuzgang und den Räumen der Patres. Dominiert wird der Hof durch eine Dreifaltigkeitssäule, die Pestsäule, sowie durch große Platanen, die einen runden Brunnen umgeben. Auf zwei Seiten des Hofes verlaufen Wandelgänge, in einer Ecke befindet sich der Zugang zu den Klassenzimmern und zum Studierzimmer. Die Schlafsäle liegen im oberen Stockwerk, über eine Treppe erreichbar, ebenso die Räume mit Bildern und Skulpturen der italienischen Künstler Giuliani und Altomonte.
Die Kirche beeindruckt durch ihre Gegensätze: Hier ein romanisches Langhaus und Querhaus, dort ein hochgotischer Hallenchor. Und dazu die gut erhaltenen Buntglasfenster, durch die bei Sonnenaufgang farbige Muster auf Altar und Kirchenboden gezeichnet werden.
Der Tagesablauf war streng geregelt: sehr zeitig aufstehen, Messe, Frühstück, dann Besuch der Schulstunden, Mittagessen, Studium (das hieß auch: Hausaufgaben erledigen). Am liebsten war uns die freie Zeit, in der wir in einem Hinterhof Fußball spielen konnten. Oder die magischen Augenblicke, wenn uns – im abgedunkelten Raum – Pater Severin Grill Geistergeschichten erzählte.
Kurz vor Weihnachten 1949 wurde ich durch einen unerwarteten Besuch meines Vaters im Stift Heiligenkreuz überrascht. Die Erinnerung an das folgende Erlebnis hat sich tief in mein Gedächtnis eingegraben: Unter dem Vorwand, die Franzi-Tante sei krank, nimmt mich Vater mit nach Wien. In der Karl-Meißl-Straße schickt er mich in einen Laden, um eine Tafel Schokolade für die Tante zu kaufen. Er geht allein voraus.
Ich klingle an der Tür zur Wohnung der Logotkas. Sie wird geöffnet. Vor mir steht eine unbekannte junge Frau: dunkles Haar, dunkle Augen, blass und krank aussehend. Wir blicken uns überrascht an. Ist das nicht … das kann doch nicht …? Mir stockt der Atem. Bevor ich den Gedanken weiterverfolgen kann, schreit sie plötzlich: „Mein Gott! Das ist ja mein Kind!“ An den Augen hat sie mich erkannt. Dann kommen ihr die Tränen. Sie kommt auf mich zu und umarmt mich.
Ich stehe steif da, wie versteinert. Außer Überraschung verspüre ich keine Gefühle – weder Freude, noch Trauer, rein gar nichts. Meine Mutter ist wieder da, aber sie ist eine Fremde geworden. Meine Gefühle gehören der Franzi-Tante als meiner neuen Mutter. Ich kann lange nicht reden.
Schließlich stammle ich: „Ich habe dich mir ganz anders vorgestellt!“ Später sollte ich meine Mutter wieder lieben lernen: Kaum ein Mensch stand mir emotional so nahe – außer meiner Frau und unseren Kindern. Damals jedoch war meine Mutter zutiefst gekränkt und traurig. Jetzt endlich war sie aus Russland zurückgekehrt, hatte nur knapp eine schwere Krankheit überstanden. Sie wollte Liebe geben, und ihr Kind hat diese Liebe nicht angenommen – es wusste nicht, wie!
Mein Vater hat es bereut, dass er meine Mutter und mich ohne jegliche Vorbereitung zusammengeführt hatte. Es sollte eine freudige Überraschung werden, doch die ging gründlich daneben. „Es war von mir sicher keine gute Idee, beide ahnungslos einander gegenüberzustellen“, schrieb er später in seiner Familiengeschichte.
Die Erzählungen meiner Mutter belasteten mich sehr. Nach einiger Zeit konnte ich dies emotional nicht mehr verkraften: „Mutter, bitte erzähl ein anderes Mal weiter! Deine Erzählungen machen mich sehr traurig oder sehr zornig!“
Die Familie findet wieder zusammen
Im Lauf der Jahre erzählte meine Mutter über Ereignisse aus der Zeit der Verschleppung: über die harschen Bedingungen im Lager, über den Hunger, über die schwere Arbeit.
Die Russen machten einige Deutsche, die Russisch verstanden, zu „Adjutanten“ der russischen Lagerleitung, um die tägliche Arbeit einzuteilen, zu koordinieren und zu überwachen. Diese Deutschen hatten über den praktischen Ablauf große Macht: Sie teilten die Menschen in Arbeitsbataillone ein, übersetzten die Anordnungen der Lagerleitung ins Deutsche und interpretierten sie im Lichte ihrer eigenen Interessen.
Einer dieser „Unterkommandanten“ blieb bei den Frauen in schlechter Erinnerung: Irgendwie war es ihm gelungen, seine eigene Frau, wohl aus gesundheitlichen Gründen, nach Hause zurückschicken zu lassen. Fortan betrachtete er die Frauen des Lagers als Freiwild. Er bot ihnen an, sie in leichtere Arbeitsgruppen einzuteilen, wenn sie ihm sexuelle Gefälligkeiten entgegenbrachten. Er hatte einen Blick auf meine Mutter geworfen, aber dabei auf Granit gebissen. Da wurde sie dem Arbeitsbataillon zugeteilt, das die schwerste Arbeit in den Kohlengruben verrichten musste. Dies konnte ihren Stolz nicht brechen, wohl aber ihre Gesundheit nachhaltig beeinflussen.
Die harten Bedingungen des Lagers kosteten fast jeder dritten Gefangenen das Leben.
Im Juli 1950 ging mein Vater schwarz über die Zonengrenze in die DDR, um auch meine beiden Brüder Mathias und Toni sowie seine Eltern nach Österreich zu holen. Sie wurden an der Grenze gefasst: Meine Brüder und meinen Vater ließen sie ziehen, die Großeltern jedoch nicht. Sie mussten zurück in die DDR.
Im März 1953 begann mein Vater beim Stift Heiligenkreuz als Pecher (Harzgewinnung) zu arbeiten. Wir erhielten eine Dienstwohnung im Hajek-Haus im schönen Helenental, unweit von Baden bei Wien. Hier gründeten meine Eltern eine Geflügelfarm. Als diese expandierte, siedelten sie nach Pfaffstätten um, wo meine Eltern ein großes Areal kauften und neue Gebäude und Stallungen bauten.
Meine beiden Brüder besuchten ebenfalls das Gymnasium im Stift Heiligenkreuz. Nach der 4. Klasse wollten sie aber nicht länger in die Schule gehen, sondern im gewachsenen Betrieb der Eltern mitarbeiten.
Mein Vater und vor allem auch meine Mutter haben Enormes geleistet. Obwohl meine Mutter im Lauf der Jahre vier Herzinfarkte und eine komplizierte Gallen- und Venenoperation überstehen musste, arbeitete sie bis zur Erschöpfung, teilte die tägliche Arbeit für die Arbeiter ein, sorgte dafür, dass der Haushalt funktionierte und … und … und. Unsere Eltern waren ein echtes Vorbild für uns Kinder, obwohl wir dies in jungen Jahren vielleicht nicht immer ausreichend gewürdigt haben. Sie gaben uns Bespiele für Motivation, Fleiß und Opferbereitschaft.
Zurück zu meinen Erfahrungen im Stift Heiligenkreuz: Die älteren Schüler – dreizehn und vierzehn Jahre – versuchten uns Neuzugänge – zehn Jahre – zu persönlichen „Sklaven“ zu machen. Sie forderten, dass wir ihre Schuhe putzen und ähnliche Dienstleistungen erbringen sollten. Wenn einer von uns nicht parierte, drohten Prügel. Sie waren dabei nicht zimperlich.
Ich war damals nicht sehr sportlich, doch ich weigerte mich, diesem Druck nachzugeben und schloss mich mit zwei weiteren Schülern zusammen: „Wenn er wieder droht, einen von uns zu verprügeln, müssen die beiden anderen je einen seiner Füße umklammern, sodass er sich nicht mehr bewegen kann! Der Dritte greift ihn von vorne an!“ Gesagt, getan: Fortan ließen uns die „Bullies“ in Ruhe!
Abt Karl Braunstorfer wurde von allen verehrt: Er war asketisch und hager und strahlte eine nach innen gewandte Geistigkeit aus. Er war unser Lateinlehrer. Viel später – im Jahr 2002 – wurde vom Konventkapitel des Stifts Heiligenkreuz ein Antrag auf Beginn eines Verfahrens zur Seligsprechung gestellt und von Kardinal Christoph Schönborn am 15. November 2008 eröffnet.
Читать дальше