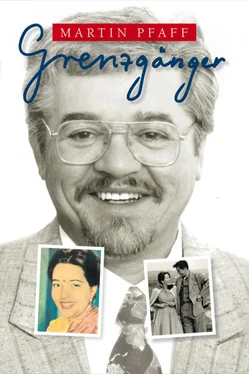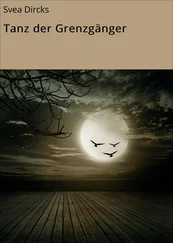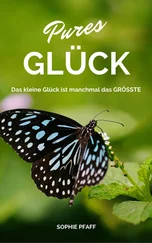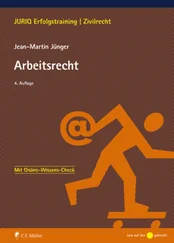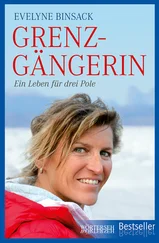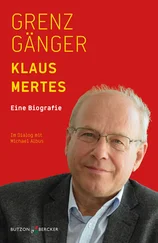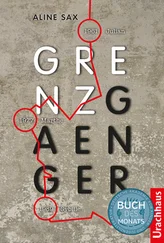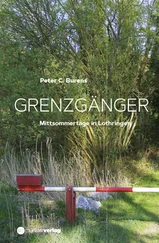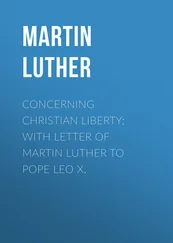1 ...8 9 10 12 13 14 ...32 Pater Prior Elred Pexar, von runder Gestalt, unterrichtete Mathematik. Der Liebling vieler Schüler war Pater Hermann Watzl, der Geschichtslehrer. Unser Zeichen- und Mallehrer war kein Priester sondern ein Laie, Herr Gargela. Zu meinem fünfzigsten Geburtstag machte er mir ein überraschendes Geschenk: Eine Karikatur von ihm, die ich mit dreizehn Jahren gezeichnet hatte. Er hatte sie all die Jahre aufbewahrt.
Auch ich habe einige meiner Arbeiten von damals aufbewahrt: Den Linolschnitt eines Propheten aus dem Alten Testament, den ich anhand einer Skulptur im Chorgestühl gezeichnet hatte. Einen Holzteller mit einem eingebrannten Bild des Stifts Heiligenkreuz. Bleistiftporträts meiner Mutter und meines Vaters. Auch die Illustration für das Logbuch der Pfadfinderpatrouille „Die Uhus“ ist darunter, der ich in Heiligenkreuz angehörte. Mein Interesse an künstlerischer Tätigkeit war groß.
Der Präfekt war Pater Berthold May, sehr fair, aber auch streng. Er arbeitete mit starken Anreizen: Angesichts meiner schulischen Leistungen und der Geschwindigkeit, mit der ich meine Hausaufgaben erledigte, bekam ich frei, während die anderen noch arbeiten oder lernen mussten. So konnte ich einen Karl-May-Band nach dem anderen verschlingen oder im Stiftshof spazieren gehen. Später kamen weitere Privilegien hinzu: Ich durfte ohne Aufsicht die alte Klosterbibliothek nutzen, eine großartige Sammlung von kirchlichen und weltlichen Büchern.
Ab 1950 übernahm Pater Adolf Niemetz die Aufgaben des Präfekten, ab 1952 Pater Alberich Strommer. Ich fragte Pater Hadmar Borowan, ob ich ihm bei den Führungen in der Altomonte- und Giuliani-Ausstellung zur Hand gehen könnte, beispielsweise beim Verkauf der Eintrittskarten an touristische Besucher. Er willigte sofort ein.
Eines Tages sagt er: „Martin, du hast lange genug zugehört. Von heute an machst du die Führungen selbst, verkaufst Eintrittskarten und rechnest einmal pro Woche mit mir ab. Hier ist der Schlüssel!“ Ich war sprachlos ob dieses Vertrauensbeweises. Die Trinkgelder der Besucher waren mir sehr willkommen. Ich kaufte davon meine erste Kamera.
In Erinnerung geblieben sind auch die Patres Paulus Niemetz, Gerhard Hradil und Niwad Hradil und Pater Albert Urban, der Chemie unterrichtete.
Pater Alberich Strommer machte Notizen über mich, die er mir bei einem späteren Besuch zeigte. „Martin Pfaff hat große, fragende Augen. Und oft bleibt ihm vor Staunen der Mund offen. Dann lacht alles! Aber er scheint sehr begabt zu sein!“, schrieb er. Später notierte er: „Martin Pfaff ist vermutlich der intelligenteste, Wenninger vermutlich der fleißigste Schüler … Der [Erst-]Genannte macht von sich reden.“ Und im Mai 1953: „Zum Vielleser Martin Pfaff, der die Bücher nur so verschlingt, sage ich: Timeo virum unis libris – Fürchte den Kenner (nur) eines Buches!“
Meine Neugier, das Fragen nach neuen Erkenntnissen und das Staunen über die Antworten liefern wohl einen Schlüssel zum Verständnis meiner intellektuellen Reise durchs Leben: Ich wurde zum Grenzgänger, weil ich jenseits der etablierten Grenzen entdeckenswerte Erkenntnisse vermutete, über das Neue erstaunt war. Hinzu kam allerdings, dass ich sehr bald das Interesse an dem Entdeckten verlor, weil mich neue Herausforderungen mehr reizten als die Vorstellung, bereits „beackertes Land“ zu pflegen. Dies sollte beispielsweise dazu führen, dass ich als Wissenschaftler das Schreiben von Textbüchern über etabliertes Wissen ablehnte. Zum Bearbeiten von Dingen, die ich schon verstanden hatte, fehlte mir die Geduld. Dafür hatte ich aber keinerlei Scheu, mich in neue Gebiete einzuarbeiten, für die ich keine systematische Ausbildung erfahren hatte. Und gar keinen Zweifel hatte ich, dass ich neuen Herausforderungen gewachsen sein würde. Doch ein Autodidakt bin ich wohl zeitlebens geblieben.
Manchmal wurde meine Neugier übermächtig. Einmal bedrängte ich meinen Lehrer immer wieder mit Fragen. Da ich nicht sofort eine Antwort bekam, stürmte ich durch die Bankreihen nach vorne, pflanzte mich vor dem Lehrer auf und verlange eine Antwort. „Jetzt!“ Dies führte zu einer disziplinarischen Maßnahme und ich wurde zum Abt geschickt. Dieser saß an seinem Schreibtisch und fragte, was passiert sei. Ich erzählte es. Er lächelte: „Sei in Zukunft ein wenig geduldiger.“
Das Stift Heiligenkreuz wurde eine Heimat für mich. Später sollte ich Pater Hermann bitten, unsere Trauung in der Stiftskirche zu vollziehen, und den Abt Karl Braunstorfer, uns danach seinen Segen für unser Eheleben zu geben.
Der Tagesablauf der Patres wurde durch das Chorgebet definiert: Um 5 Uhr 15 die Vigilien (40 Minuten), um 6 Uhr die Laudes (20 Minuten) und an Werktagen um 6 Uhr 25 die Konventmesse (45 Minuten). Weitere Stationen im Tagesablauf sind um 12 Uhr Terz und Sext (15 Minuten), um 12 Uhr 55 Totengedenken und Non (15 Minuten), um 18 Uhr 50 die Feierliche Vesper (25 Minuten) und um 19 Uhr 50 Komplet Salve Regina (20 Minuten).
Wir Klosterschüler nahmen an einigen dieser Chorgebete teil, insbesondere aber an der täglichen Konventmesse. Eine besondere Ehre war es, als Ministrant an der Feierlichen Konventmesse an Feiertagen teilzunehmen und das Messbuch oder den Stab des Abts tragen zu dürfen. Beide Ehren würden mir des Öfteren zuteil.
Ich war einer der Heiligenkreuzer Sängerknaben. Wir sangen zusammen mit den Patres den Gregorianischen Choral, in der ersten Reihe des schönen Chorgestühls stehend, also vor den Patres. Auch deshalb freute ich mich besonders, als Jahre später die CD „Chant – Music for Paradise“ mit Gregorianischen Gesängen der Zisterziensermönche des Stifts Heiligenkreuz zu einem Bestseller avancierte. Und ich war sehr bewegt, als Papst Benedikt XVI. bei seinem Besuch im Stift Heiligenkreuz den Satz sagte: „Wenn wir immer zum Singen, Preisen, Loben und Anbeten Gottes zusammentreffen, wird ein Stück Himmel auf der Erde präsent.“
Tatsächlich bedeutet der geregelte Tagesablauf eine Stütze für viele Menschen, ein Korsett, das Halt und Geborgenheit vermittelt. Allerdings bevorzuge ich auch heute noch die Freiheit, meine Werte und Interpretationen selbst zu wählen.
Ich war von zu Hause durchaus an autoritäre Erziehungsmethoden gewöhnt. Aber außer von meinem – durch die Wirren der Nachkriegszeit überforderten – Großvater hatte ich keine Bekanntschaft mit der Rute oder dem Riemen gemacht. Ich sah es damals nicht als abwegig an, wenn einige der Patres körperliche Strafen anwandten. Über einige Schläge mit der Rute oder eine Ohrfeige gingen diese körperlichen Strafen ohnehin nicht hinaus.
Ich selbst hatte in den vier Jahren meines Aufenthalts in der Oblatenschule des Stifts Heiligenkreuz nur zweimal Erfahrungen mit solchen „Erziehungsmethoden“ gemacht. Einmal, als ich einen Mitschüler verfolgte, der aus dem Innenhof des Klosters durch den Torbogen hinaus in den Vorhof lief, was uns ohne Aufsicht der Patres verboten war. Das Schicksal ereilte mich nach der Rückkehr in der Form von Pater Albert: Mit einer gewaltigen Ohrfeige streckte er mich nieder.
Der zweite Anlass betraf mein ungeduldiges Zwischenrufen in der Geschichtsstunde. Sichtlich entnervt forderte Pater Hermann Watzl: „Pfaff, folge mir in das Turnzimmer!“ Dort musste ich mich über den Turnbock legen. Nach dem ersten Schlag mit der Rute packte mich eine maßlose Wut: Ich rutschte vom Bock herunter und protestierte lautstark gegen die Züchtigung. Sie hatte meinen Stolz verletzt. Alles, was ich in der Lehrstunde wissen wollte, war eine Antwort auf eine mich bewegende Frage! Pater Hermann war wohl überrascht über meine heftige Reaktion. Er stellte seine Züchtigung sofort ein und gab mir zwei Schilling: „Geh und kauf dir Zuckerln! Und sei nicht so vorlaut in der Zukunft während des Unterrichts!“ Er blieb weiterhin mein Lieblingslehrer.
Zu Recht wird sexueller Missbrauch von Schülern durch katholische Priester aufs Schärfste kritisiert. Ich kann bezeugen, dass mir in den vier Jahren im Stift und später im Neukloster in Wiener Neustadt kein Fall dieser Art bekannt wurde. Dergleichen wäre in der engmaschigen Gemeinschaft nicht verborgen geblieben. Allerdings bereitete mir die überstrikte Sexualmoral der Kirche erhebliche Probleme. Wenn schon sexuelle Fantasien während der Pubertät als Sünde angesehen werden, die es zu beichten gilt und für die Buße erforderlich ist, schafft dies erhebliche psychische Belastungen für einen jungen Menschen. Noch heute sehe ich das als eine Form der Gehirnwäsche, der psychologischen Knechtschaft. Die geforderte Reue über Gedanken oder Taten, die keinen anderen Menschen betreffen, und damit verbundene Empfehlungen wie beispielsweise zum Fasten sind einer freien Entfaltung der Persönlichkeit nicht unbedingt förderlich.
Читать дальше