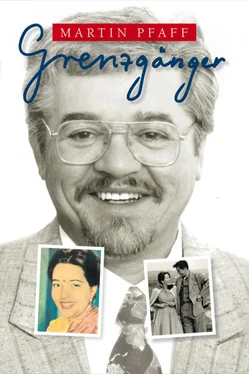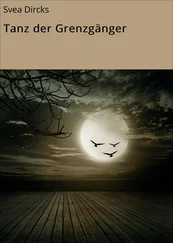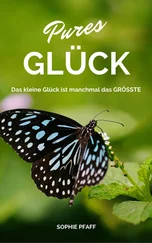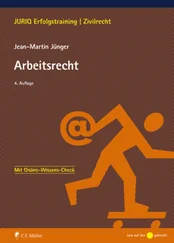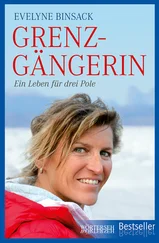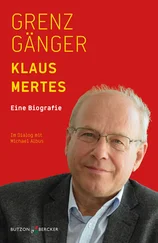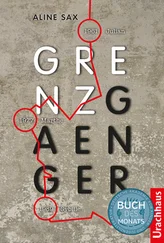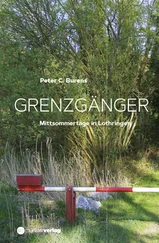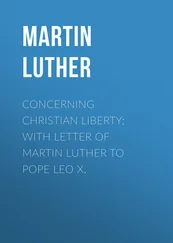Auf der Wiese angekommen, werden Männer, Frauen und Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt: Volksbündler auf der einen Seite, Mitglieder der Treuebewegung auf der anderen. Erstere kommen ins Ghetto in Lengyel. Letztere dürfen in ihre Häuser zurückkehren.
Eine Frau protestiert heftig. Als sie an ihrem Haus vorbeiziehen, ist es schon verwüstet: Die Möbel sind im Hof verstreut, teils demoliert, teils verschmutzt.
So wurden meine Großeltern und wir drei Kinder aus unserem Haus vertrieben. Wir durften nur das Allernotwendigste mitnehmen – das Vieh, Futter, die letzte Ernte und alle Vorräte mussten zurückgelassen werden.
Mit Ochsenwagen wurden wir nach Lengyel ins Schloss des Grafen Apponyi gebracht. Es war von einem Park mit riesigen Bäumen umgeben, wie ich sie bis dahin nicht gesehen hatte. Drinnen sah es weniger idyllisch aus: In leeren Räumen war Stroh aufgehäuft, als Grundlage für die Schlafstellen von Tausenden Menschen. Liegeplatz neben Liegeplatz, die Familien zusammen. Von den Donauschwaben wurde dieses Lager als Ghetto bezeichnet. Und ein Ghetto war es – nur diesmal für Schwaben.
Das Gebäude hatte als russisches Lazarett gedient, bevor die Deutschen einquartiert wurden. „Das Stroh war zertreten und verschmutzt. Da haben wir dann alle darauf schlafen müssen. Und unten haben sie eine Latrine ausgehoben. Und da mussten wir draufgehen“, erzählte mir Mari viele Jahre später.
Nicht alle akzeptierten die unwürdigen Bedingungen widerspruchslos. Eine Frau aus Tevel, die Leni Bas, protestierte lautstark. Sie wurde mit Wasser übergossen und in die „Federkammer“ gesteckt. Die herumfliegenden Federn kamen in Augen und Haare, sie war mit Flaum bedeckt. Dann holten die Wärter die Frau heraus und bespritzten sie wieder mit Wasser. Zudem musste sie vor den zusammengetrommelten Lagerinsassen tanzen. „Schaut, wie es denen geht, die sich gegen uns auflehnen!“, so die Botschaft der Wärter.
Doch damit nicht genug: Im oberen Zimmer hatten die Russen ihre Notdurft verrichtet: „Die Mädchen mussten hinaufgehen und diese mit ihren Händen zusammenrechen!“, so Mari. „Dann wurden alle wieder auf den Hof getrieben. Die Mitglieder der Familien wurden für unterschiedliche Arbeitseinsätze getrennt. Die Alten und die Kinder blieben zunächst in Lengyel.“ Die älteren Männer mussten auf den Ländereien des Guts arbeiten.
Mein zweijähriger Bruder Toni holte sich im verunreinigten Stroh eine Infektion. Dazu Mari: „Er bekam ein großes Geschwür hinter dem Ohr. Dieses öffnete sich, und es floss Eiter herunter. Aber wir hatten keinen Verband, nur ein Taschentuch. Dabei hatten wir Mühe, dieses zu waschen. Später hat mein Vater Blätter gesammelt und unter die Wunden gehalten, damit der Eiter nicht den Hals hinunterlief.“
Nach einiger Zeit wurde uns freigestellt zu gehen, wohin wir wollten – nur nicht zurück in unsere Häuser. Diese waren mittlerweile von Ungarisch sprechenden Szeklern – von den Schwaben „Czángo“ genannt – in Besitz genommen worden.
Dazu erzählte mir Kathi Jahre später: „Als wir von Lengyel zurückkamen, hatten wir nichts zum Anziehen außer den Kleidern am Leib. Deshalb entschloss sich meine Großmutter, die sehr gut Ungarisch sprechen konnte, mit mir zu Hegilis (Hausname ihrer Familie und meiner Mutter vor ihrer Heirat) zu gehen: Wir wollten einige der zurückgelassenen Kleider holen. Sie bat den Czángo, der in unserem Haus eingezogen war, Kleider mitnehmen zu dürfen.
Der ist mit der Mistgabel in der Hand hinter uns hergerannt. Mit der Mistgabel hat er uns verjagt!“
Als Mitglied der Treuebewegung hatte mein Onkel sein Haus behalten dürfen und wir fanden bei ihm Unterschlupf. Das Haus lag drei Kilometer außerhalb Tevels. Seine Frau war wie meine Mutter zum Arbeitsdienst in die Sowjetunion verschleppt worden. Seine beiden Söhne Steffi (Stephan) und Johann und ich gingen zu Fuß von der Czárda – so wurde sein Hof genannt – ab Herbst 1945 in die Volksschule in Tevel, drei Kilometer hin, drei Kilometer zurück. Öffentliche Verkehrsmittel gab es nicht.
Während der strengen Winter 1945/46 und 1946/47 fanden meine Großeltern mit uns drei Schülern Unterschlupf unweit des Schulgebäudes. Wir wohnten zu fünft in einem kleinen Zimmer. Auf dem Holzofen wurde gekocht und das Zimmer beheizt. Viel Platz blieb nicht.
Hier zeigte sich, wie stark meine Großmutter war: Sie war klein und von zierlicher Gestalt, mit dunklen Haaren und großen dunklen Augen. Doch im Gegensatz zum Großvater, der von den Entwicklungen überfordert und fast hilflos erschien, wusste sie, wie wir unter diesen Umständen weiterleben konnten. Wenn sich mein Großvater gegenüber uns herumtollenden Kindern nicht mehr zu helfen wusste, griff er manchmal zum Riemen. Großmutter aber war intelligent und hilfreich bei unseren schulischen Aufgaben.
Meine Kusine Mari erzählte: „Sie war kräftemäßig für die Landwirtschaft nicht geeignet, aber beim Spinnen, Stricken und Nähen sehr geschickt und flink!“
Während wir auf der Czárda waren, im April 1945, hörten wir: „Die Czángo kommen! Nehmt euch in Acht!“ Niemand wusste, ob sie die Deutschen als Freiwild betrachten würden. Deshalb flohen die Frauen und Mädchen, zusammen mit uns Kindern, in den nahen Wald. Nach drei Tagen kehrten wir jedoch auf die Czárda zurück.
Die Czángo waren einfache, meist arme Leute. Viele waren Holzfäller oder Schäfer in Moldawien gewesen. Für sie bedeutete die Zuweisung von Bauernhöfen mit Ländereien eine erhebliche Verbesserung ihrer Lebensgrundlage, allerdings um den Preis der Vertreibung der Donauschwaben.
Mein Großvater mütterlicherseits rief denen, die seinen Hof okkupierten, im Zorn zu: „Wartet nur, es wird noch anders kommen!“ Sie sahen dies als massive Drohung an. Am Abend riefen sie die Polizei und bewirteten sie mit Alkohol, um sie aggressiver zu machen. Mein Großvater war von einem Gemeindeangestellten, dem Klee-Richter (kleiner Richter), gewarnt worden: Er übernachtete auf dem Heuboden seines Nachbarn. In angetrunkenem Zustand erschienen nun die Polizisten mitten in der Nacht vor dem Haus meines Onkels: Alle Bewohner mussten in Nachthemden im Hof antreten. Mein Großvater war offensichtlich nicht unter ihnen. Auch die intensive Suche im Haus durch die Polizisten half nichts.
Da kam die Drohung: „Sagt uns, wo der Propst-Großvater ist, oder wir erschießen euch!“ Alle schwiegen. Deshalb konzentrierten sie ihre Aufmerksamkeit auf meine Großmutter. Auch sie sagte ihnen nichts. Daraufhin nahmen sie sie mit ins Polizeirevier, schlugen sie wiederholt. Mit dem Gewehrkolben in der Hand musste sie in die Knie gehen, wieder aufstehen, in die Knie gehen, rauf, runter …
Am nächsten Morgen wurde sie nach Bonyhád zum Gericht gebracht. Ihre Beine waren stark angeschwollen. Als sie wieder zurückkam, konnte sie nicht mehr richtig schlafen. Aber ihren Mann hat sie niemals verraten.
Unter diesen Umständen konnte mein Großvater nicht länger in Tevel bleiben – früher oder später hätte die Polizei ihn gefunden. Also floh er nach Àgád, eine ungarische Gemeinde, in der er als Kind Ungarisch gelernt hatte. Dort fand er eine alte Frau, die ihn von damals kannte. Sie nahm ihn auf und gab ihm Arbeit als Knecht.
In der Zwischenzeit kam sein Sohn Martin, der Bruder meiner Mutter, vom Militärdienst zurück. Er fand Arbeit in einer Mühle unweit der Czárda, wo seine Frau als Köchin arbeitete. Ihre eine Tochter, meine Kusine Mari, kam mit dreizehn Jahren als Dienstmädchen nach Szekszárd, die andere Tochter, meine Kusine Kathi, arbeitete mit ihren zwölf Jahren als Kindermädchen bei einer Familie, sechzig Kilometer entfernt von ihren Eltern. Meine Großmutter mütterlicherseits fand mit meinem kleinen Bruder Toni eine kleine Wohnung in der Mühle.
Mari blickte später auf diese Zeit zurück: „In den ungarischen Dörfern waren die Deutschen durchaus gut angesehen, vor allem als billige Arbeitskräfte. Außer Unterkunft und Essen gab es für uns Jugendliche nicht viel: Zusammen mit einer Teveler Freundin kaufte ich uns von unserem Monatslohn ein Kilogramm Weintrauben.“
Читать дальше